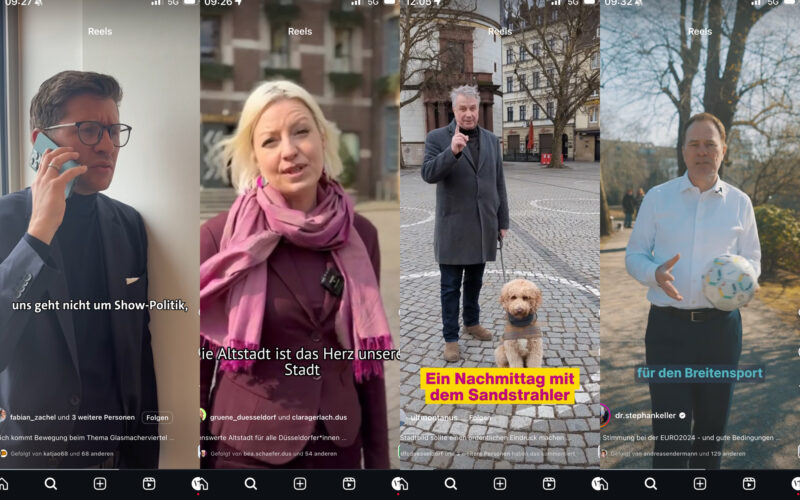Verleger geht in den Stadtrat
FDP-Mitglied ist Felix Droste (57) seit knapp 40 Jahren. 2017 trat er als Kandidat zur Landtagswahl an, war parallel engagiert im Dachverband der Heimatvereine. Am 2. Juni wird er als Ratsherr an seiner ersten Ratssitzung teilnehmen, nachgerückt für einen anderen Liberalen, Sascha Henrich. Seine Schwerpunkte will Droste künftig politisch überall da setzen, wo es um die Verbesserung der Behörden im Service und Nutzung moderner Kommunikationstechnik geht, um eine effizientere Verwaltung zu erreichen. Behörden, so sieht es der Diplom-Volkswirt und Verlagskaufmann, haben ähnliche Problem wie Unternehmen: Sie brauchen dringend qualifiziertes Personal, das immer schwerer zu finden ist. Um das zu lösen, müsse man stärker auf Künstliche Intelligenz setzen.
Dass er als einer der führenden Vertreter des bedeutendsten Medienhauses dieser Stadt mit seiner politischen Arbeit in einen Interessenkonflikt geraten könnte, sieht er nicht. Er habe nie Einfluss auf die Redaktion genommen, und werde das auch künftig ganz sicher nicht tun. Ich glaube ihm das, aber sehe dennoch ein Problem. Denn eine schwierige Lage für die RP-Redaktion entsteht, ohne dass Droste aktiv wird.
Weil Felix Droste eben nicht irgendein politisch engagierter Bürger dieser Stadt ist. Er ist seit 2012 Vorsitzender des Aufsichtsrates der Rheinischen Post Mediengruppe. Also an einer der höchsten Positionen dieses Verlages, nicht ohne Einfluss bei Entwicklungen des Hauses. Außerdem hat seine Familie erhebliche Anteile an der Gruppe, er ist somit mehrfach involviert. Die „Rheinische Post“, immer noch Zugpferd des Unternehmens, ist inzwischen de facto die einzig verbliebene mediale Stimme von Gewicht in der Stadt. Ehemalige Konkurrenten haben sich entweder auf ein Minimum zurückgezogen, oder sie beziehen ihre Inhalte – WZ, NRZ – von der RP, branchenintern gern als „gelber Riese“ bezeichnet. Der lokale Radio-Sender Antenne Düsseldorf gehört ebenfalls zur RP.
Das heißt, die wirklich relevante Berichterstattung über die Politik der Stadt (und damit auch über die diesbezüglichen potenziellen Aktivitäten des Felix Droste) laufen über eine Zeitung, die ihm quasi in Teilen gehört.
Nun soll dem als integer bekannten, von Mitarbeitern des Verlages geschätzten Mann hier nicht unterstellt werden, Einfluss geltend machen zu wollen. Das hat er bisher – jedenfalls nach meinen Erfahrungen – nie getan, auch nicht in seinen politik-fernen, aber in Düsseldorf dennoch relevanten Tätigkeiten. Und für ihn, wie er im Gespräch mit mir sagte, ist selbstverständlich, das auch künftig nicht zu tun.
Die Düsseldorfer Lokalredaktion wird trotzdem jedes Mal, wenn sein Tun oder das seiner Partei Thema ist (oder sein sollte) zumindest in einen gedanklichen Konflikt geraten. Um die Frage nämlich, wie damit umzugehen ist. Eine Zwickmühle. Denn: Egal, was man tut – es wird immer Unsicherheit über das Verhalten geben. Hat Droste dadurch einen Bonus oder einen Malus? Vorteil für die FDP oder Nachteil? Und wer die Gepflogenheiten in Verlagshäusern kennt, der weiß, dass eine Erwähnung der eigenen Firma, von Mitarbeitern und vor allem denen aus den oberen Etagen niemals stattfindet, ohne dass die Führungsetage das abgesegnet hat.
Eine vergleichbare Problematik gab es bei der RP schon einmal: Von 1961 bis 1983 saß der damalige Herausgeber der Rheinischen Post, Gottfried Arnold (gest. 2015), für die CDU im Bundestag. Als sich jedoch in den 1970er Jahren die Stimmen in der CDU mehrten, die ihn dazu aufforderten, seine mediale Macht im Sinne der Union auszuüben, blockte er das ab und zog die Konsequenz – er verließ seine politischen Ämter, trat 1980 vom Vorsitz der CDU-Düsseldorf zurück und verzichtete bei der Wahl 1983 auf eine erneute Kandidatur für den Bundestag. Er hatte erkannt, dass die Zeiten von partei-nahen Zeitungen zu Ende gingen, und man – auch im Sinne des wirtschaftlichen Erfolges – trotz klarer konservativ-bürgerlicher Haltung Ausgewogenheit anstreben sollte. Die Redaktion dürfte das damals insgeheim erleichtert zur Kenntnis genommen haben. In diesen Jahren änderte die RP auch ihren Untertitel. Aus „Zeitung für christliche Politik und Kultur“ wurde „Zeitung für Politik und christliche Kultur“. Weil das „christlich“ als Adjektiv vor „Politik“ zu viel Nähe zur CDU (Christdemokratische Union) signalisierte. Eine Änderung, die Arnold damals mit betrieb, gewiss in enger Abstimmung mit den – neben seinem Vater Karl Arnold (gest. 1958) – beiden anderen Gründern der RP, Anton Betz (gest. 1984) und Erich Wenderoth (gest. 1993).
Auch in Drostes Partei, der FDP, wird der Einstieg des Medienmannes mit gemischten Gefühlen gesehen. Sein Stadtverband (Düsseldorf-Nord) hat ihn aufgestellt, nach interner Vermutung womöglich mit Blick auf seine medialen Hintergründe und die sich vielleicht daraus ergebenden Vorteile, zum Beispiel einer Beißhemmung beim journalistischen Platzhirsch. Das halten andere Liberale für naiv, ja für regelrecht schädlich, denn sie fürchten einen im negativen Sinn besonderen Umgang mit ihren Themen. Ob und wie Droste im Rat oder den Ausschüssen auftreten wird, ist noch nicht sicher. Sein Versuch, wirtschaftspolitischer Sprecher der Liberalen im Rat zu werden, fand in der Partei keine Unterstützung, nach unseren Informationen auch wegen der hier geschilderten Vorbehalte. Er sitzt im Ausschuss für öffentliche Einrichtungen, im Rechnungsprüfungsausschuss und dem Ausschuss für Wirtschaftsförderung – alle wichtig, aber nicht die Plattform für große Diskussionen und Auftritte.
Droste schätzt diese Gremien als die geeigneten Stellen ein, in denen er seine Kompetenz einbringen kann. Seine Partei und sich sieht er in der Rolle des Beobachters, vor allem – buchstäblich – mit Blick auf die Grünen. Er fürchtet bei ihnen eine Tendenz, die Stadt durch allzu lockeren Umgang mit Geld, auch geliehenem, auf Dauer zu überfordern. Das sei langfristig fatal, weil steigende Ausgaben bei sinkenden Einnahmen den Spielraum einengen und in eine Abwärtsentwicklung führen. Mit den Merkmalen solch politischer Zyklen hat er sich schon in einem Studium beschäftigt, und mehr denn je fasziniert ihn dieser enge wechselseitige Zusammenhang zwischen agierender Politik und Einfluss auf die Volkswirtschaft.
Das erlebt er künftig live.