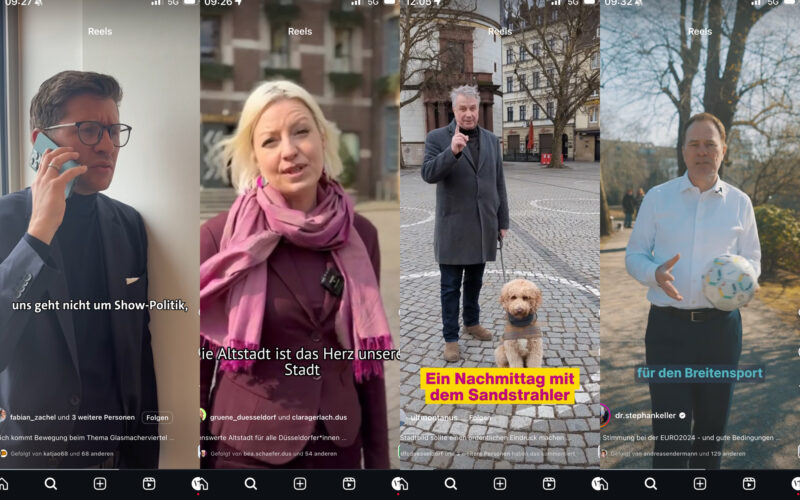Was Düsseldorf von Mallorca lernen kann

In Corona-Zeiten hat sich in der Altstadt eine Partyszene etabliert, die es vorher in diesem Umfang nicht gab. Seit der Pandemie kommen die jungen Frauen und Männer nicht mehr mit dem Ziel in die Altstadt, drinnen zu feiern, sondern verabreden sich zu Open-Air-Partys. Alkoholische Getränke bringen sie mit oder kaufen sie in einem der vielen Kioske der Altstadt. Die Rheinuferpromenade zwischen Apollo/Kniebrücke und Burgplatz wird zur riesigen Freifläche und ist an den Wochenend-Nächten dicht bevölkert. Mit den inzwischen bekannten Folgen.
Wer die Berichte darüber liest und jemals auf Mallorca an der Playa de Palma mit ihrem berüchtigten Ballermann, der benachbarten Schinkenstraße und einigen Ecken in Magaluf war, dem wird das bekannt vorkommen. Denn dort kennt man diese Probleme seit vielen Jahren und geht inzwischen immer konsequenter dagegen vor.
Wie ist die Lage an der Playa de Palma?
Diese Promenade ist rund sechs Kilometer lang, als Problemzone gelten etwa zwei Kilometer. Seit etlichen Jahren hat sich dort eine Szene etabliert, die man anfangs („Ballermann“) noch tolerierte, heute aber offen als Sauftourismus anprangert. Längst haben sich die Partys auf die Straße verlagert, das berüchtigte Komasaufen und das gemeinsame Trinken von Sangria aus Eimern sorgte für europaweite Berühmtheit.
Wann kippte die Stimmung?
Bereits vor mehreren Jahren wurden die Stimmen jener immer lauter, die das nicht länger hinnehmen wollten. Wie in Düsseldorf auch waren es vor allem Anwohner mit ihrem lauten Protest gegen das lautstarke Feiern und die üblen Begleiterscheinungen. Wildpinkeln, Müll, Erbrochenes, komatös auf dem Bürgersteig liegende Menschen, Reste menschlichen Stoffwechsels direkt vor der Haustür – die Anwohner gingen empört buchstäblich auf ihre Straße, die sie zu verlieren drohten.
Außerdem kam Widerstand aus der Immobilien- und Tourismusbranche. Denn die europaweiten Schlagzeilen über die Exzesse an diesem Strand vor Mallorcas Hauptstadt zogen das Image der Ferieninsel nach unten. Dem wollte man möglichst früh vorbeugen, weil man langfristig wirtschaftliche Schäden fürchtete. In einer aktuellen Entscheidung hat man nun auf einer weiteren, in jedem Sommer zur Partymeile mutierten Straße (Carrer Missió de Sant Gabriel) den Verkauf und den Konsum von Alkohol ab 1. April verboten. Ladeninhaber, die sich nicht an das Verbot halten, zahlen bis zu 3000 Euro Strafe. Die Straße liegt neben einer Riesendisko namens Megapark und läuft direkt auf die Strandpromenade.
Wie reagierte die Regierung?
Zuerst zögerlich, dann aber immer strenger. Zurzeit gilt ein Alkoholkonsumverbot auf einigen Straßen. Um das wirksamer umsetzen zu können, versucht man, auch den Verkauf von Alkohol per Verbot zu unterbinden. Das Problem ist die Kontrolle der Regeln. Bei starkem Andrang sind dort tausende Menschen dichtgedrängt unterwegs. Und das nicht nur nachts. Die Partys fangen in der Regel schon vormittags an, jeden Tag. Es gibt also keine Konzentration auf einige wenige Nächte, denn die Menschen sind im Urlaub und verbringen ihre freie Zeit auf der Insel. Ein erheblicher Teil bucht ein möglichst billiges Hotel, das – wenn überhaupt – nur für kurze Schlafpausen genutzt wird. Weil früher viele am Strand geschlafen haben, ist das untersagt und wird auch sanktioniert.
Inzwischen wird auch von der Regierung sehr offen kommuniziert, man lege keinen Wert mehr auf „solche Gäste“ und werde künftig auf Qualitätstourismus setzen. In der mallorquinischen Bevölkerung gibt es eine große Mehrheit für diese Einstellung, aber auch Widerspruch: Diese Art des Tourismus bringt viel Geld, hunderte Jobs hängen daran.
Welche weiteren Probleme gibt es?
An den mallorquinischen Brennpunkten sind häufig Prostituierte unterwegs, die nicht selten kriminell werden und ihre Freier bestehlen. Außerdem gibt es Scharen von illegalen Händlern, die Kleidung, billigen Schmuck und Souvenirs verkaufen. In der Hochsaison ist die Gegend ideales Umfeld für Taschendiebe.
Haben die Behörden das Problem im Griff?
Die Verbote sind strenger als in Deutschland, aber die Kontrollen funktionieren bestenfalls stellenweise. Ähnlich wie in Düsseldorf haben sowohl die kommunalen als auch die polizeilichen Dienststellen zu wenig Leute, um wirklich gegen die Auswüchse Erfolg zu haben.
Wie will man weiter vorgehen?
Unter anderem durch Pläne, die man mit sozialer Kontrolle umschreiben könnte. An mehreren bisher problematischen Stellen in Arenal und benachbarten Gegenden entstehen immer mehr Hotels der Luxusklasse, ältere, billigere Häuser werden entweder kernsaniert oder abgerissen für neue Herbergen. Mit einem so entstehenden neuen Umfeld hofft man, ebenfalls Druck auf diese Art der Partymeile auszuüben.
Und was kann Düsseldorf jetzt lernen?
1. Das Verbot von Alkoholverkauf und -konsum wirkt.
2. Wer Regeln setzt, muss das Durchsetzen kontrollieren können.
3. Alle Beteiligten müssen an einem Strang ziehen: Gastronomie, Stadt, Polizei und Tourismusverband.
4. Eine an Qualität orientierte Prägung der unmittelbaren Umgebung kann helfen. Das muss nicht – wie in Palma – baulich passieren, sondern kann auch durch kulturelle Events erfolgen.