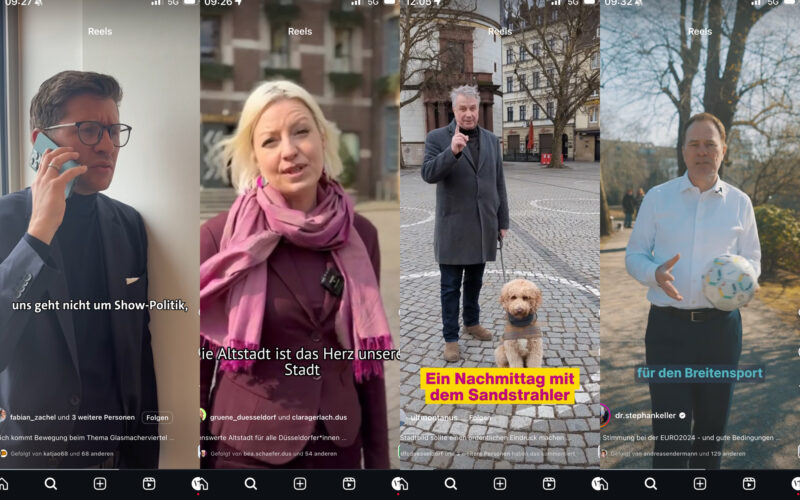Worringer Platz: Einst ein grauer, heute ein grüner Schandfleck

Wer auf dem Worringer Platz aus der Straßenbahn steigt, steht mitten im Gewusel von Autos, Straßenbahnen, Bussen und Lkw. Karlstraße und Kölner Straße, zwei stark genutzte Verkehrsachsen, treffen dort aufeinander. Die Folgen: hohe Verkehrsbelastung, viel Dreck in der Luft, viel Lärm und einer der Unfallschwerpunkte der Landeshauptstadt. Hundertmal pro Jahr kracht es, also mehrmals die Woche.
Viele Radfahrer*innen suchen sich daher lieber andere Routen, nehmen Umwege in Kauf, um diesen gefährlichen Crash-Hotspot zu umgehen. In ein paar Wochen oder Monaten sollen die beiden hochbelasteten Straßen allerdings Radwege erhalten haben und somit das Radfahren sicherer werden. „RADschlag“ heißt das Projekt der Stadt für ein durchgängiges Radhauptnetz in Düsseldorf.
Doch der eigentliche Problemfall ist das, was Radfahrer*innen genauso wie andere Verkehrsteilnehmer*innen offenbar am liebsten links liegen lassen: die Insel inmitten des Verkehrsknotens. Diese Freifläche sollte zu Anfang des neuen Jahrtausends mit beachtlichem planerischem Aufwand und einem beherzten Griff in die Kasse der Stadt zu einer „grünen Insel“ gestaltet und ihres Schmuddel-Images entledigt werden. Im Jahr 2005 war feierliche Eröffnung. Das Projekt jedoch, fragt man Anlieger und Passanten, scheint gründlich schief gegangen zu sein, manche spotten „GRÜNdlich schief!“
Die dreieckige Verkehrsinsel ist zwar seither bei Tag und Nacht sichtbar grün: Sie hat grüne Pflastersteine mit einem grün leuchtenden LED-Raster, lange Reihen grellgrüner „Stadtsofas“ aus Glasbausteinen sowie einen langen türkis-grünen Spieß in der Platzmitte (der „Grüne Strahl“) bekommen und mit großen Platanen ohnehin ein „grünes Dach“. Doch offenbar ist durch den Umbau aus dem ehemals grauen Schandfleck lediglich ein in verschiedenen Grüntönen schimmernder Schandfleck geworden.
Begrünen und beleuchten sind zwei häufig genutzte Komponenten zur Aufwertung innerstädtischer Plätze – allerdings ist in der Regel echtes Grün gemeint und keine grün gefärbten versiegelten Flächen. Zweifellos erhöhen Sitzplätze die Aufenthaltsqualität eines Platzes ebenfalls. Die Stadt Düsseldorf schreibt auf ihrer Internetseite zum Worringer Platz unter anderem: „grün leuchtende „Stadtsofas“ … laden zum Verweilen ein“. Die langen Bankreihen sollten mit ihren hohen Rückenlehnen den Platz einfassen, den Lärm des Verkehrs ausschließen.
Allerdings werden solche Sichthindernisse auf innerstädtischen Plätzen von anderen kritisch gesehen, weil sie schlecht einsehbare Nischen für zwielichtige Gestalten wie Drogenhändler schaffen. Und ohne Frage werden auch „marginalisierte Gruppen“ (Wohnungslose, Suchtkranke, etc.) durch diese Gestaltung „zum Verweilen“ eingeladen. Auf Drängen der Ordnungskräfte, die die fehlende Einsehbarkeit der Platzfläche beim Vorbeifahren kritisierten, wurden die hohen Rückenlehen an der Südkante bereits wieder abmontiert. Schon 2016 bezeichnete der damalige Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) den Platz als „Fehlplanung“, doch bis heute hat die Stadt nichts wesentliches mehr verändert.
Roberto Tomasella betreibt an der Worringer Straße seit fast 45 Jahren eine Gelateria und hofft, dass die Stadt bald tätig wird. Seiner Beobachtung nach wachse die gesamte Szene stetig, wobei auch die Kriminalität steige. Er hat sich erklären lassen, eine mögliche Lösung liege darin, die langen Bankreihen durch Einzelsitzplätze zu ersetzen. Dies würde den problematischen, daher nicht erwünschten Gruppen das lange Verweilen erschweren. Den stadtplanerischen Ansatz dahinter nennen Fachleute „Defensive Architecture“: eine abwehrende Architektur, auch Hostile Architecture (feindliche Architektur) genannt. Der Umbau des Immermannhofs ist ein Beispiel unter vielen für diesen städtebaulichen Trend. Dort hat man die Sitzplätze und Hochbeete, die als Drogenverstecke genutzt wurden, abgeschafft. Der erwünschte Erfolg trat ein: Viele Wohnungslose und Drogenabhängige wanderten ab.
In unmittelbarer Nähe des Worringer Platzes, an der Erkrather Straße, sitzt der Verein Düsseldorfer Drogenhilfe. Michael Harbaum leitet das Hilfszentrum und sieht die Hauptursache der nun angespannten Situation in der „städtebaulichen Vorgehensweise“. Nehme man der Szene ihre Aufenthaltsflächen, konzentriert sie sich an immer weniger Punkten, zurzeit eben vornehmlich am Worringer Platz. Mit den bisherigen stadtplanerischen Schachzügen werden die Betroffenen nicht von der Straße geholt und betreut, sondern lediglich von A nach B verdrängt.
Auch das lange leerstehende Postgebäude an der Erkrather Straße – mittlerweile abgerissen – war eine wichtige Anlaufstelle für die verschiedenen Gruppen. Dort konnten sich Wohnungslose einen Unterschlupf suchen und Menschen in nicht einsehbaren Ecken ihre Drogen konsumieren. „Letztlich ist der Worringer Platz übriggeblieben“, sagt Michael Harbaum und hält die Maßnahmen der vergangenen Jahre für Planungsfehler. Die Süchtigen können sich in Düsseldorf kaum noch zurückziehen, dabei will diese Gruppe laut Harbaum gar nicht öffentlich konsumieren. Die Konzentration, das Aufeinandertreffen der verschiedenen Gruppen, fehlende Rückzugsorte und häufige Polizeipräsenz setze deren Mitglieder*innen zunehmend unter Druck.
Und dieser Druck wirkt sich aus. Auf dem Worringer Platz betreibt Hasan A. seit 20 Jahren einen Imbiss. Direkt vor der Tür werde gedealt, gespritzt, und es müssten ständig Fäkalien und Müll beseitigt werden, erzählt sein Mitarbeiter Khalil. Immer wieder würden Kund*innen angepöbelt, angebettelt oder gar mit Spritzen oder Messern attackiert. „Völlig unhaltbare Zustände“, sagt Khalil, der selbst bereits mehrfach angegriffen und verletzt wurde. Nun hat Hasan A. einen Bereich um seinen Imbiss herum inklusive der Sitzbänke mit einem Zaun absperren lassen. Damit möchte er seinen Kund*innen und Mitarbeiter*innen ein akzeptables Umfeld bieten und sie vor Übergriffen schützen. Die unerwünschten, da in Teilen aggressiven Gruppen sind infolge der Absperrung auf die andere Seite des Platzes abgewandert. Wie schnell einzelne Personen tätlich werden, zeigt ein Video auf Khalils Handy, in dem ein bedrohlich mit einem Messer herumfuchtelnder Mann Zutritt zum Imbiss erzwingen will.
Das zeigt aber auch meine persönliche Erfahrung. Ich bin von einem halben Dutzend gewaltbereiter, teils hysterischer Personen eingekesselt, mit Kaffee übergossen und minutenlang beschimpft und genötigt worden, weil ich während meiner Recherchen für diesen Artikel zur Gedächtnisstütze ein paar Übersichtsaufnahmen gemacht habe. Warum nicht wenige Menschen den Worringer Platz als gefährliche Ecke bezeichnen und ihn wenn möglich meiden, habe ich eindrücklich erlebt.
Es bleibt im negativen Sinne spannend, wie es auf dem Worringer Platz weitergehen wird: Ob Hasan A. seinen Zaun behalten darf oder ob es seitens der Stadt planerische und organisatorische Maßnahmen gibt, um die Situation vor Ort nachhaltig zu verbessern. Es sei nicht sinnvoll, den Worringer Platz für marginalisierte Gruppen unattraktiver zu machen, ohne für sie echte Alternativen ausgearbeitet zu haben, meint Michael Harbaum. Er sagt: „Das sind ja alles Menschen mit Gehirn. Warum aber bezieht man sie bei der Stadtplanung überhaupt nicht mit ein?“ Mit dem Sankt-Florians-Prinzip („Verschon mein Haus, zünd‘ andere an“) müsse jetzt endlich mal Schluss sein in Düsseldorf.
Quellen/Weiterführende Links
Der neue Fahrradnetzplan von Düsseldorf
Verkehrsunfallstatistiken für Düsseldorf
Die Pläne zur Umgestaltung des Worringer Platzes
Ein ausführlicher Artikel über defensive Architektur