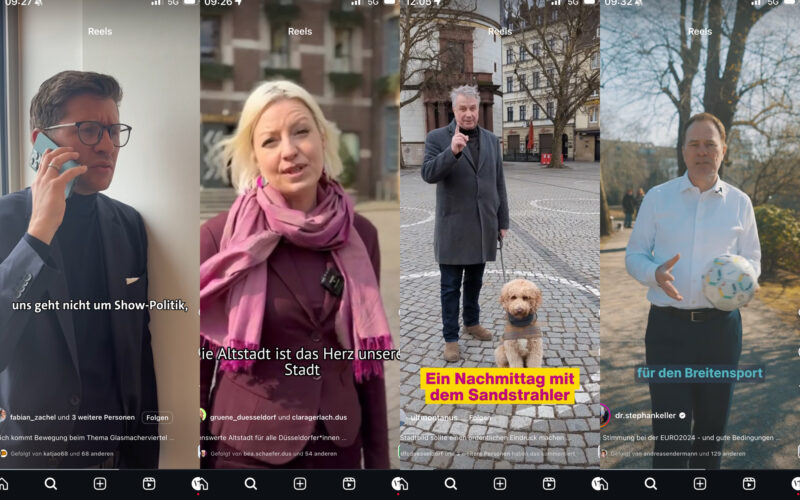Als das Eis nach Düsseldorf kam

Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts hat sich in Deutschland so einiges getan. Vier Staatsformen sind gescheitert. 25 neue Staatsoberhäupter kamen ins Amt. In all den Wirren der deutschen Geschichte hat sich nur weniges erhalten. Italienische Eismacher und ihr Eis sind eine dieser Ausnahmen – zumindest im Westen Deutschlands. Ihr Leben dort konnten selbst zwei Weltkriege nicht nachhaltig erschüttern.
Wann genau in Düsseldorf das erste italienische Eis verkauft wurde, das kann Margit Schulte Beerbühl, Professorin an der Heinrich-Heine-Universität, heute nicht mehr mit Sicherheit sagen. Sie kann nur schätzen, dass es spätestens in den 1890er-Jahren gewesen sein muss. Ansonsten weiß sie so ziemlich alles zur Düsseldorfer Geschichte der kalten Nascherei. Wo es das traditionsreichste Eis gibt? Im seit 1912 bestehenden Eiscafé Da Forno in Pempelfort. „Schmeckt bis heute“, sagt Schulte Beerbühl. Wie der Begriff der Eisdiele entstand? Weil die italienischen Familien in den 1910er-Jahren begannen, ihr Eis aus dem eigenen Wohnungsfenster zu verkaufen. Die vorher genutzten Eiskarren mit der klassischen „Gefrorenes“-Aufschrift waren da gerade wegen der zu hohen Salmonellen-Gefahr verboten worden.
Schulte Beerbühl forscht seit acht Jahren zu dem Thema. Erst ging es nur um die Vorbereitung einer Ausstellung zu italienischen Eismachern am Niederrhein, die 2017 nach längerer Vorbereitung in Neuss stattfand. Dann hatte sie Freude daran gefunden. Das Wissen, das sie in dieser Zeit angehäuft hat, teilte sie zum Abschluss eines besonderen Sommerprogramms der Universität Düsseldorf mit. Dort hatten zuvor vor allem Naturwissenschaftler ihre Forschungsergebnisse zum „Eis“ präsentiert.
Die Historikerin hat sich theoretisch mit alldem auseinandergesetzt. Diejenigen, die es Tag für Tag praktisch tun, sind aktuell nur schwer zu erreichen. Es ist Sommer, Hochsaison der Eisproduktion. Eine Mail, ein paar Anrufe – irgendwann meldet sich Roberto Palatini zurück. Palatini, 63, ist naturgemäß viel zu jung, um die Anfänge des Eismachens in Düsseldorf erlebt zu haben. Und doch gibt es wohl kaum jemanden in dieser Stadt, der so viel über die lokale Eisgeschichte zu erzählen hat. 1955 eröffneten sein Vater Giuseppe und sein Onkel Serafino an der Graf-Adolf-Straße/Ecke Königsallee ihr erstes Eiscafé. Heute leitet Palatini das gleichnamige Familienunternehmen. „Das ist sofort wie eine Rakete eingeschlagen, es gab ja wenig Möglichkeiten“, sagt er über die Anfänge seiner Vorfahren.
Die Geschichte der Palatinis ist typisch. Wie die ersten Eismacher Ende des 19. Jahrhunderts kamen die Brüder aus der norditalienischen Provinz Belluno nach Düsseldorf, genauer gesagt aus Cortina d’Ampezzo, dem heute berühmten Wintersportort. „Damals gab es dort allerdings nur die Landwirtschaft“, sagt Palatini. Es sind nur zwei Täler in dieser Provinz, aus denen fast alle klassischen italienischen Eismacher-Familien in Deutschland stammen. Von dort flohen sie vor der Armut in ein neues Leben, wie Schulte Beerbühl in ihrer Forschung herausgefunden hat.
Giuseppe und Serafino sind zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Sie eröffnen ihr Eiscafé an einer der pulsierendsten Stellen der Stadt, mit Tanzlokalen und Kinos gleich um die Ecke. Und das inmitten des deutschen Wirtschaftswunders. Der „absoluten Blütezeit“ der italienischen Eismacher, wie Schulte Beerbühl sagt. Die Eiscafés verkauften damals zwar in der Regel nur Eis und Kaffee, vermittelten dabei aber auch ein begehrtes Lebensgefühl an die Italien-hungrigen Deutschen. Den Traum von Sonne und Strand. Dolce Vita, das süße Leben.
Roberto Palatini ist zwar in Deutschland geboren, die meiste Zeit des Jahres verbringt er als Kind allerdings in Verona. Dort wächst er auf, geht zur Schule. Im Winter hat das Eiscafé geschlossen, dann ist die Familie daheim vereint. Im Sommer kommt Roberto immer zum Helfen nach Düsseldorf. In die Graf-Adolf-Straße und in die Rethelstraße, wo Vater und Onkel bald ein zweites Café eröffnen. Am liebsten steht er dort in dem rund vier Mal vier Meter großen Raum, in dem das Eis hergestellt wird. „Das war mein Ding. Ich habe immer lieber Eis gemacht als Eis verkauft“, sagt er.
An der Sortenvielfalt hat sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht viel geändert. Die meisten Eiscafés verkaufen Vanille, Erdbeere, Schokolade und Nuss. Für alles andere fehlen schlicht die Zutaten. „Das Eis dieser Zeit würden Sie heute nicht mehr essen“, sagt Roberto Palatini über das Gefrorene seines Vaters. Es sei „sehr kalt“ gewesen, nur mit Wasser, Milch, Eiweiß und Zucker hergestellt worden. Nicht vergleichbar mit dem heutigen Angebot.
Im Vergleich zum frühen 20. Jahrhunderts hatte sich dann aber doch schon einiges gebessert. Schulte Beerbühl erwähnt beim Termin in der Heinrich-Heine-Universität den Teerfarbstoff, der damals nicht nur Eis, sondern häufig auch Kuchen beigemischt wurde, um dem Produkt die jeweils erwünschte Farbe zu geben. Dass dieser Krebs erregen kann, wussten die Forscher damals schon, genutzt wurde er dennoch. In den Archiven hat die Historikerin dazu auch eine Strafanzeige aus dem Jahr 1907 gefunden. Ein lokaler Eismacher hatte sein besonderes Waldbeereis mit grünem Farbstoff gefärbt, der auch nach einem Tag immer noch auf den Lippen seines klagewilligen Kunden klebte.
Als Palatinis Vater nach Düsseldorf kommt, ist der Teerfarbstoff hingegen Geschichte und die italienischen Eismacher haben so einige große Krisen überstanden. Auch mit diesen hat sich Schulte Beerbühl intensiv beschäftigt. Während des Ersten Weltkriegs schlägt sich Italien 1917 auf die Seite der Alliierten, und die Italiener kehren daher erstmals in Massen in ihre Heimat zurück, um einer Internierung zu entgehen. In den 1930er-Jahren will die „Deutsche Arbeitsfront“ eine Schließung der italienischen Cafés, aber die Eismacher haben zunächst noch Glück: Die Freundschaft zwischen Hitler und Mussolini schützt sie. Mit fortdauerndem Krieg verlassen dennoch viele das Land – und kehren unmittelbar nach 1945 zurück, um ihre zerstörten Geschäfte wiederaufzubauen.
Zumindest bei den Palatinis begann die Saison jedes Jahr nach Karneval. „Auf die Besoffenen hatte mein Vater keine Lust“, sagt Roberto Palatini. Wenn im Sommer der Sohn dann da war, wurde gerne mal die Kaffeemaschine ausgeschaltet. Statt Kaffee zu trinken, sollten die Kunden nur Eis essen. Sein Vorschlag, doch mal Cola oder Fanta anzubieten, kam nie gut an. Als 1985 sein Vater plötzlich stirbt, bricht Roberto sein fast fertiges Medizinstudium ab und übernimmt das Familienunternehmen, das er bis heute leitet. Statt auf vier mal vier Metern wird das Palatini-Eis heute auf 1000 Quadratmetern in einer Zentralküche in Schwalmtal hergestellt.
„Wir machen zwar Industrieeis, aber noch mit dem Touch Eisdiele“, sagt Palatini. „Keine künstlichen Aromen, kein gar nichts.“ Zwischenzeitlich eröffnete er zahlreiche neue Eiscafés, die er alle mittlerweile wieder verpachtet oder verkauft hat. Mit einer Ausnahme: Das Eiscafé Palatini in Eller wird bis heute von seiner Frau geleitet. Ansonsten beliefert er noch rund 20 Cafés in der Region, betreibt sie aber nicht (mehr) selbst. Produziert wird vor allem für den Handel. Gerade in Corona-Zeiten sei das ein Segen gewesen.
Beim Pressetermin in der Universität kämpft sich Margit Schulte Beerbühl mittlerweile an einem Eis ab, das sie extra auf Fotografenwunsch geöffnet hat. Das Industrieprodukt eines großen Herstellers. „Das ist aber kein italienisches Eis“, sagt sie zur Pressesprecherin des Dekanats. Die entschuldigt sich mit logistischen Gründen. Den klassischen Eismachern haben die Großkonzerne längst den Rang abgelaufen – über 80 Prozent beträgt der Marktanteil des industriell hergestellten Eis in Deutschland. Und wahrscheinlich wird sich die Eisproduktion immer weiter automatisieren.
Mit dem „Gefrorenen“ des späten 19. Jahrhunderts hat das Eis der Zukunft wohl nicht mehr viel zu tun. Und auch Roberto Palatinis Verzicht auf Aromen hat da schon etwas Antiquiertes. „Ich komme aus der Tradition“, sagt er. „Neuigkeiten wird es immer geben. Für mich ist das nicht mehr aktuell.“ So lange er noch die Produktion in Schwalmtal leitet, wird sich am Palatini-Eis nicht mehr viel verändern.