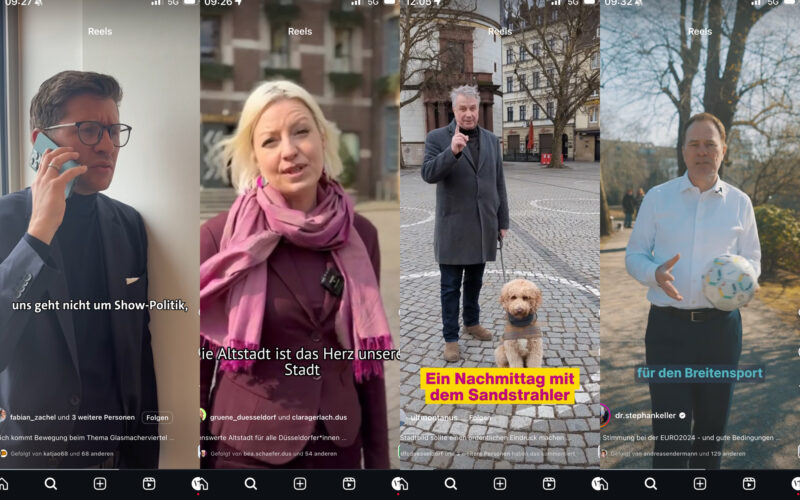Der Reporter geht in eine Altbierkneipe und trinkt ein Glas Milch

Ich habe den Plan, den ich an jenem 7. Dezember 2023 in die Tat umsetze, schon vor langer Zeit gefasst. Seitdem fehlte die Gelegenheit, es fehlte sicher auch der Mut, aber wenn ich es jetzt nicht mache, mache ich es nie mehr. 15.30 Uhr, Bolkerstraße. Ich betrete den Goldenen Kessel, das Gasthaus der Altbierbrauerei Schumacher in der Düsseldorfer Altstadt. Links geht’s in einen Raum, in dem alte Männer mit Biergläsern zusammen an Stehtischen herumhängen. Ich aber gehe nach rechts, in den Raum mit den Tischen zum Sitzen und zum Essen. Ich möchte die Ungeheuerlichkeit, die ich geplant habe, mit einer weiteren Bestellung abschwächen.
Alles in diesem Raum strahlt Tradition aus. Auf einer Tafel steht mit Kreide geschrieben „Herzlich Willkommen in der ältesten Hausbrauerei Düsseldorfs!“. Vor mir auf dem Tisch steht ein Senfpöttchen, das Holz ist dunkel, die Schrift so etwas wie Fraktur. Die Brauerei heißt auch nicht mehr Brauerei, sondern Altbier-Manufaktur, ganz so, als würde das Bier nicht in riesigen Kesseln vor sich hin gären, sondern mit den Händen geformt.
Ich bestelle eine Frikadelle mit Bratkartoffeln, Spiegelei und Salat und außerdem so beiläufig wie möglich: ein Glas Milch. Der Köbes, ein mittelalter, gedrungener Mann, lässt sich nichts anmerken, aber ich bin mir sicher, dass es in ihm arbeitet. Wenige Minuten später serviert er mir die Milch in einem Glasbecher, so ein Exemplar, das man von der Glühwein-Bestellung auf dem Weihnachtsmarkt kennt. Auf dem Glas steht „Düsseldorfer Sternchenmarkt“.
0,2 Liter kalte Milch befinden sich in dem Glas, so zeigt es der Strich an. Irritiert schaue ich auf der Getränkekarte nach. Dort werden 0,25 Liter für 2,20 Euro angeboten. Das entspricht exakt der Menge, die auch in ein Altbierglas passt. Vermutlich geben sie hier so selten Milch aus, dass sie überhaupt nicht wissen, in welches Glas sie gehört. Vielleicht würden sie sich auch eher die Finger abhacken, als Milch in ein Altbierglas zu füllen.
Ich nehme einen Schluck. Die Milch ist kalt, sie ist frisch, sie stammt von einer Kuh. Als das Essen kommt, esse ich es, ab und zu nehme ich noch einen Schluck.
Okay, was soll der Unsinn?
Wie von Zauberhand geleitet, bin ich vor einigen Monaten im Internet auf die Getränkekarte vom Goldenen Kessel gestoßen. Unter den ganzen Bieren, Spirituosen und Limonaden las ich: Milch. Einfach nur Milch. Ich schaute auf die Getränkekarten in den Schänken der anderen Altbier-Institutionen. Füchschen, Uerige, Kürzer, Schlüssel, sie haben Milchkaffee auf der Karte stehen, vielleicht Kakao, aber niemals ein einfaches Glas Milch. Das gibt es nur im Goldenen Kessel und im Schumacher-Stammhaus an der Oststraße.
Das ist jetzt eine gemeine Stelle, den Text auszublenden, das wissen wir.
Unser Journalismus ist werbefrei und unabhängig, deshalb können wir ihn nicht kostenlos anbieten. Sichern Sie sich unbegrenzten Zugang mit unserem Start-Abo: die ersten sechs Monate für insgesamt 1 Euro. Danach kostet das Abo 10 Euro monatlich. Es ist jederzeit kündbar. Alternativ können Sie unsere Artikel auch einzeln kaufen.
Schon Mitglied, Freundin/Freund oder Förderin/Förderer?