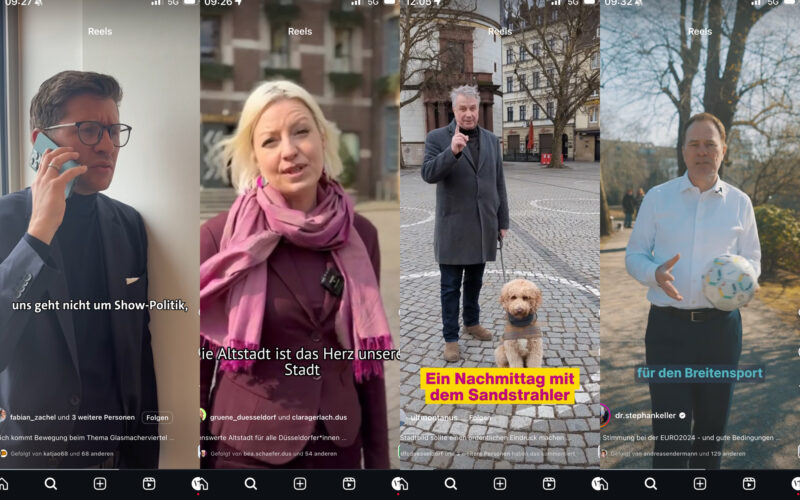Der letzte Zeuge: Zwei Stolpersteine und ihre Geschichte

„Friedingstraße“: Die Schilder der Haltestelle sehen täglich Tausende – Fußgänger und Autofahrer ebenso wie die Passagiere der Straßenbahnen auf dem Weg vom oberen Teil Gerresheims in den unteren, oder andersherum. Sie flankieren die Benderstraße, die breite Einkaufsmeile des Stadtteils, doch für ihren Namen steht eine schmale Tempo-30-Abzweigung Pate. Da wiederum, wo eben diese Friedingstraße einen Knick macht und in einer Reihe farbenfroh gestrichener Jugendstilreihenhäuser sanft ansteigt, verbirgt sich die Geschichte einer Gerresheimer Familie mit jüdischen Wurzeln: Vor der Nr. 4, einem weißen Mehrfamilienhaus mit Vorgarten und Schieferdach, sind zwei Stolpersteine in den Asphalt eingelassen.
Auf dem einen steht: „Hier wohnte Hans Heidenheim. Jg. 1887. Gedemütigt / entrechtet / versteckt / überlebt.“
Und auf dem anderen: „Hier wohnte Walter Heidenheim. Jg. 1925. Flucht 1944. Schweiz. Abgeschoben. 1944 Buchenwald. Ermordet 1945.“

Um aus erster Hand mehr zu erfahren, muss man nach Lübeck reisen. Dort lebt Till Heidenheim, das letzte noch lebende Mitglied der Familie. Der 92-jährige war vor zehn Jahren bei der Stolpersteinverlegung durch den Künstler Gunter Demnig mit dabei – nachdem er Gerresheim zuvor über Jahrzehnte gemieden hatte. Hans Heidenheim, gestorben 1949, war sein Vater – und Walter Heidenheim einer seiner Brüder.
Seit 1992 sind in Europa mehr als 105.000 Stolpersteine verlegt worden, 372 davon in der NRW-Landeshauptstadt, koordiniert vom Förderkreis der städtischen Mahn- und Gedenkstätte. Till Heidenheim ist einer der wenigen, die noch aus eigener Erfahrung erzählen können, was ihren Familien angetan wurde. Als Düsseldorf 1945 von den Amerikanern befreit wird, ist er 13 Jahre alt. Nach dem Schulabschluss macht er als Kaufmann Karriere in der Filmbranche, zieht 1971 mit seiner Frau Hildegard aus beruflichen Gründen nach Hamburg. Nach Hildegards Tod 2005 geht er nach Lübeck, wohnt seitdem im ersten Stock eines Altbaus im Stadtteil St. Gertrud.
Durch die hohen Fenster des Wohnzimmers fällt der Blick ins Grüne: Der Stadtpark liegt vor der Tür. Schon vor dem Termin hat Till Heidenheim in einer Mischung aus Ironie und rheinischem Humor per Mail angekündigt: „Sie werden hier keinen vergreisten Senior vorfinden. Ich bin weiterhin bemüht, mich weiterzubilden und stehe nach Meinung meiner Freunde und Bekannten mit weitestgehend klarem Verstand im sich ständig verändernden Leben.“ Fürs Interview hat er eine Kanne Kaffee vorbereitet und diverse Fotos und Materialien bereitgelegt. Er nimmt auf dem breiten Sofa Platz. Überall hängen Bilder – sowohl Kunstwerke, als auch Fotos von Angehörigen. Auf dem Tisch liegt ein Smartphone. In seinem Alltag ist Till Heidenheim aktiv im Netz unterwegs, kommentiert auf Facebook, kommuniziert täglich per Whatsapp, E-Mail und telefonisch. „Manchmal klingelt hier mehrmals pro Stunde das Telefon.“ Im Fernsehen schaut er bevorzugt Dokus zu historischen Themen.

Auch mit der Herkunft seiner Familie hat er sich viel befasst, reiste schon nach der Wende nach Sachsen und Thüringen, besuchte die Gräber seiner Vorfahren. Till Heidenheims Vater stammt aus einer jüdischen Chemnitzer Fabrikantenfamilie. Sein Urgroßvater Philip Heidenheim (1814-1906) war Gymnasiallehrer und Rabbiner in Sondershausen.
Hans Heidenheim – „Vati“, wie Till Heidenheim ihn immer noch nennt – verschlägt es als einzigen der Familie ins Rheinland. Nach einer Lehre als Schaufensterdekorateur heiratet er 1912 eine Düsseldorferin. Aus dieser Ehe geht ein Jahr später Sohn Gustav, genannt „Gustel“, hervor, der Jahrzehnte später auch im Leben seines Halbbruders Till noch eine prägende Rolle spielen wird. Hans Heidenheim muss im ersten Weltkrieg als Sanitäter an die Front, wird verwundet, kehrt zurück nach Düsseldorf, lässt sich scheiden – und heiratet 1921 in zweiter Ehe die Schauspielerin Maria Brömme, („Maja“, geb. 1896). Es kommen Hanns Heinz („Hannes“, 1922), Walter (1925) und Helga (1927) zur Welt – und kurz vor Beginn der Nazi-Diktatur: Till.
92 Jahre später lässt der jüngste der Heidenheims in Lübeck seine Kindheit Revue passieren. Dabei betont er immer wieder, wie er die Lücken in den eigenen Erinnerungen und Familienerzählungen durch Forschungen seiner „neuen Gerresheimer Freunde“ hat schließen können – den Geschichtslehrern und Regionalhistorikern Jürgen Tenbrock und Peter Stegt.
Als Till Heidenheim 1932 in der Flurklinik in Flingern geboren wird, residiert die Familie noch am mondänen Kaiser-Wilhelm-Ring 39 in Oberkassel, direkt am Rhein. Im Jahr darauf zieht sie an die Friedingstraße in Gerresheim. Vater Hans ist in den zwanziger Jahren in die aufstrebende Film- und Kinobranche eingestiegen. Zunächst eröffnet er an der Oststraße einen Filmverleih, dann nimmt ihn die Universum Film AG, kurz UFA, in Babelsberg unter Vertrag, als zuständigen Vertreter für die Region des heutigen NRW.
Am 30. Januar 1933 wird Adolf Hitler durch den Reichspräsidenten Paul von Hindenburg zum Reichskanzler ernannt. Für Hans Heidenheim, noch im Vorjahr von der UFA für seine gute Arbeit ausgezeichnet, hat die Machtergreifung gravierende Folgen. Hitler ernennt Joseph Goebbels als Propagandaminister, somit ist dieser auch für die UFA zuständig. „Mein Vater wurde wie alle Filmjuden Knall auf Fall zum 1. Mai 33 entlassen. Viele von ihnen emigrierten daraufhin nach Amerika, mein Vater beschloss zu bleiben.“
Düsseldorf erweist sich bei der stufenweisen Entrechtung als düsterer Vorreiter: Bereits am 10. März 1933 kommt es in der Stadt zu gezielten antisemitischen Angriffen und Diffamierungen. SA-Trupps bringen an jüdisch geführten Geschäften Schilder an, um die Bevölkerung aufzuhetzen. Aufschriften: „Deutsche, kauft nicht bei Juden!“ oder „Deutsche kauft in deutschen Geschäften!“ Jüdische Geschäftsleute werden überfallen, Läden geplündert.
Ab 1. April 1933, im Zuge reichsweit organisierter Aktionen, verschlimmert sich die Situation weiter: Die Nazis stellen Mahnwachen auf – sowohl vor dem Warenhaus Tietz an der Königsallee (heute: Galeria Kaufhof) und dem Modehaus Gustav Carsch an der Alleestraße (heute: Heinrich-Heine-Allee), als auch vor kleineren Geschäften an der Schadowstraße und anderswo. Eine Gaststätte in der Altstadt warnt mit einem Schild über dem Eingang: „Juden betreten das Lokal auf eigene Gefahr.“
In dieser hasserfüllten Stimmung findet Hans Heidenheim zunächst noch einen Job als Vertreter für Getränke- und Zigarettenautomaten. 1934 trifft er eine Entscheidung, um seine Familie zu schützen: Er und die Kinder werden vom Pfarrer der Gemeinde St. Margareta in Gerresheim getauft. „Das war insofern konsequent, weil mein Vater sich schon in den zwanziger Jahren innerlich vom Judentum gelöst hatte und wir durch meine Mutter ohnehin fromm-katholisch erzogen wurden.“ Was im späteren Gerresheimer Vorkriegs-Alltag für den kleinen Till bedeutet: Er muss samstags und sonntags die Herz-Jesu-Andacht am Gerricusplatz besuchen. Wenn er vorher bei schönem Wetter draußen spielt, beneidet er seinen Freund Siggi. Der ist evangelisch und darf weiterspielen.

Ab September 1935 treten die Nürnberger Gesetze in Kraft und geben der antisemitischen Ideologie der Nationalsozialisten eine pseudo-juristische Grundlage. In diesem rassistischen Weltbild spielen ein Übertritt zum Katholizismus und die Mitgliedschaft in einer katholischen Jugendgruppe keine Rolle. Mit einem jüdischen Vater und einer sogenannten „arischen“ Mutter gelten Till Heidenheim und seine Geschwister bei den Nazis als „Halbjuden“ und „Mischlinge ersten Grades“: „Ich habe mich in meiner Kindheit immer als katholisch empfunden, nie als jüdisch. Und dann wurde ich plötzlich von einigen Nachbarn als Judenlümmel beschimpft oder aufgefordert, statt dem Bürgersteig die Straße zu benutzen. Viele Kinder aus der Friedingstraße, mit denen ich früher noch gespielt hatte, bekamen von ihren Eltern Kontaktverbot.“
In der Nachbarschaft überwiegen Mitläufertum und Teilnahmslosigkeit, mit wenigen Ausnahmen: So dürfen – wie Till Heidenheim sich erinnert – die sechs teils gleichaltrigen Kinder der an der gleichen Straße lebenden Familie eines Dr. Schneyder weiterhin mit ihm und seiner Schwester Helga spielen, „zur Sicherheit allerdings nur in deren Haus, nicht draußen“. Und dann ist da auch noch der schon erwähnte Siggi, der eigentlich Siegfried heißt, und in der Kindheit Till Heidenheims bester Freund ist: „Der Siggi Krüger hatte von seiner Oma, die sich um die Erziehung kümmerte, ausdrücklich die Erlaubnis, mit mir draußen unterwegs zu sein.“
1938 verliert Vater Hans Heidenheim, inzwischen 51 Jahre alt, durch die Nazi-Gesetze seinen Job, wird von der Stadt fortan zu schweren körperlichen Arbeiten zwangsverpflichtet. Auf dem Gerresheimer Waldfriedhof und anderen Düsseldorfer Friedhöfen muss er Gräber ausheben, und als „Schienenkratzer“ muss er die Rillen der Straßenbahnschienen sauber halten. Um die Familie durchzubringen, trägt Hans Heidenheim nebenbei in Oberbilk die Berliner Illustrierte aus. Till Heidenheim erinnert sich bis heute daran, wie er – der jüngste Sohn – ihn dabei begleiten durfte. Seine Brüder Walter und Hanns Heinz, genannt „Hannes“, gehen damals bereits seit Jahren zur Schule, spüren auch dort die Ausgrenzung durch Lehrer und Mitschüler. So wird Hannes, zu diesem Zeitpunkt 16, am Oberkasseler Comenius-Gymnasium von der Schule geworfen, nachdem dort seine jüdische Abstammung bekannt geworden ist.
Allgemein gilt in Düsseldorf seit Inkrafttreten der Nürnberger Gesetze 1935 eine „Rassentrennung an öffentlichen Schulen“. Die meisten jüdischen Schülerinnen und Schüler gehen so zwangsläufig auf die im April 1935 in einem Nebengebäude der Synagoge eröffnete Jüdische Volksschule an der Kasernenstraße. Dennoch erlebt der sechsjährige Till Heidenheim im gleichen Jahr, in dem seine Brüder verhöhnt, verspottet und ausgeschlossen werden, die Einschulung an der katholischen Volksschule „Unter den Eichen I“ in Gerresheim: „Dort hat man wohl zum Glück noch nicht gewusst, dass die Heidenheims als jüdische Familie galten.“
Bei den antisemitischen Pogromen der Nacht des 9. November 1938 ermorden die Nazis und ihre Helfershelfer in Düsseldorf 17 Menschen, 70 werden schwer verletzt. Sie zerstören die Synagoge und die jüdische Volksschule, plündern jüdische Geschäfte, Büros und Wohnungen. Auf den vorbereiteten Listen von SA, SS und Gestapo steht offenbar auch die Friedingstraße 4. Vor der Wohnungstür der Heidenheims im ersten Stock ereignet sich an diesem Abend eine Szene, die Till Heidenheim bis heute vor Augen hat: „Ein Nachbar, der SA-Mann Räder aus der Wohnung über uns, stets in Uniform auftretend, stellte sich mit ausgebreiteten Armen schützend vor uns, als seine Parteigenossen gröhlend und hasserfüllt auf uns zu kamen, und sagte: Hier nicht, die Heidenheims sind anständige Juden. Und meine Mutter scharte uns Kinder in dieser Situation wie eine Glucke um sich, bevor der Pöbel weiterzog.“
Durch die Intervention bleibt die Wohnung der Heidenheims verschont. Die in der Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf verwahrten Aufzeichnungen seines Bruders Hannes haben Till Heidenheim die Dramatik der als kleiner Junge erlebten Situation noch einmal verdeutlicht: „Vor unserem Haus lag ein Haufen Pflastersteine bereit, um die Scheiben einzuschlagen und zu plündern und möglicherweise Schlimmeres – genau da, wo jetzt die Stolpersteine liegen. Dank der Recherchen von Jürgen Tenbrock weiß ich, dass dieser Nachbar, Herr Räder, Verwandte an der Friedingstraße hatte, die von meiner Mutter gepflegt worden waren. Daher kam wohl sein Einsatz für uns. In jedem Fall war er unser Schutzengel, nur das zählt.“
1939 zieht die Familie in Erwägung, nach Brasilien auszuwandern, aber das erfährt Till Heidenheim erst nach dem Krieg. Letztlich bleiben die Heidenheims in Düsseldorf. Der Schulbetrieb geht nach Beginn des Zweiten Weltkriegs zunächst weiter. 1942 hat Till Heidenheim die vier Klassen der Volksschule in Gerresheim abgeschlossen und die Prüfung für die Mittelschule an der Prinz-Georg-Straße geschafft. Doch als „Mischling ersten Grades“ wird dem Zehnjährigen der Besuch verwehrt. Er muss zurück an die alte Volksschule, inzwischen mit Dependance an der Benderstraße, und ist dort prompt dem Hohn und Spott der Klassenkameraden ausgesetzt. „Das war eine Demütigung für mich. Allerdings hat mich meine Klassenlehrerin Fräulein Dappert sehr liebevoll wieder aufgenommen. Ihren Namen habe ich bis heute nicht vergessen.“
Während Familie Heidenheim versucht, unter ständigem Druck und in dauernder Unsicherheit den Alltag zu bewältigen, bleibt sie durch die sogenannte „Mischehe“ bei den Vernichtungsplänen der Nationalsozialisten erst einmal außen vor: Seitdem im Oktober 1941 der Befehl zur Deportation deutscher Juden aus dem Reichsgebiet erteilt worden ist, gehen vom Güterbahnhof Derendorf aus immer wieder Transporte mit bis zu 1000 Menschen aus Düsseldorf und Umgebung Richtung Osten. Im Januar 1942 wird bei einer geheimen Besprechung – der „Wannseekonferenz“ – von führenden Nationalsozialisten die bereits begonnene Massenvernichtung aller europäischen Juden systematisch organisiert.
In Folge der Novemberpogrome ist die Volksschule für die wenigen verbliebenen jüdischen Schülerinnen und Schüler von der Kasernenstraße an die Grafenberger Allee 78 gezogen. Nach den ersten Deportationen wird sie im Juni 1941 geschlossen, und im Jahr darauf werden jüdische Schulen im Deutschen Reich komplett verboten. Diese fortschreitende „Endlösung der Judenfrage“ nimmt im Spätsommer 1944 auch die jüdischen Ehemänner „arischer“ Frauen ins Visier: Vater Hans Heidenheim erhält einen Brief der Gestapo. Er soll sich schon zwei Tage später mit Handgepäck am Schlachthof einfinden. Im kalt-bürokratischen NS-Jargon ist von „Versammlungsstelle“ die Rede. „Mischehepartner“ wie Hans Heidenheim sind für das KZ Theresienstadt vorgesehen. Von letzterem ist in dem Schreiben natürlich nicht die Rede. Aber die Heidenheims wissen: Der Schlachthof ist der Ort in Düsseldorf, von dem aus die Transporte in die Vernichtungslager im Osten koordiniert werden. Der Brief kommt einem Todesurteil gleich.
Anfang des Jahres hat Till Heidenheims 19-jähriger Bruder Walter bereits die Flucht in die Schweiz angetreten, um dem Dauerstress und der Ungewissheit des Düsseldorfer Alltags zu entkommen. Nun beschließt die Familie, dass Vater Hans untertauchen soll. Maja Heidenheim hat eine Idee, die ihrem Mann das Leben retten soll. „Meine Mutter kontaktierte ihre Halbschwester in Bayern. Über die wurde ein fingierter Brief meines Vaters, in dem er von seiner geglückten Flucht berichtet, in die Schweiz geschmuggelt und von dort nach Düsseldorf geschickt – in der Hoffnung, dass die Gestapo ihn abfängt.“ Das beabsichtigte Resultat: Offiziell gibt es danach keinen Hans Heidenheim mehr in Düsseldorf.
Nachdem ihr Ehemann nicht an der „Versammlungsstelle“ auftaucht, wird Maja Heidenheim an die Prinz-Georg-Straße vorgeladen, in die Gestapo-Leitstelle. Beim Verhör durch den Kriminalsekretär Georg Pütz – seit 1940 im „Exekutivdienst“ des „Judenreferats“ tätig – gibt die gelernte Schauspielerin so gekonnt die überrascht-verzweifelte Ehefrau, deren Mann sich wie befohlen auf den Weg zum Schlachthof gemacht habe, dass ihr scheinbar geglaubt wird.

Ob der Trick geklappt hat, ist unklar. Denn natürlich erzählt die Gestapo Maja Heidenheim später nicht, dass – so ist es in den Akten nachgewiesen – der Brief tatsächlich abgefangen und gelesen worden ist. In jedem Fall ist es an Vater Hans, sich „unsichtbar“ zu machen. Gemeinsam mit Tills 22-jährigem Bruder Hannes schleicht er, wie dieser später berichten wird, nachts durch dunkle Straßen von Gerresheim nach Bilk, versteckt sich in einer Fabrik an der Himmelgeister Straße, wo er zuvor als Zwangsarbeiter Grabkreuze beschriften musste. Später findet er für zwei Wochen Unterschlupf in einem Nebengebäude des Franziskaner-Klosters an der Oststraße.
Hannes bekommt derweil ebenfalls Post von der Gestapo: Er soll in das Arbeitslager Lönnewitz bei Leipzig deportiert werden. Um dem zu entgehen, simuliert er eine Nervenlähmung, die ihn arbeitsunfähig macht. Er hat Erfolg, die Deportation wird ausgesetzt. Als die Stadtverwaltung beschließt, im Franziskaner-Kloster Flüchtlinge unterzubringen, wird für Vater Hans Heidenheim die eigene Wohnung an der Friedingstraße 4 zum Versteck. Hannes gesellt sich dazu, hat beschlossen ebenfalls abzutauchen. Till Heidenheim erzählt: „1944 war durch einen Fliegerangriff unser Haus stark beschädigt und ein Zimmer der Wohnung unbewohnbar geworden. Vor der Tür zu diesem Zimmer platzierten mein Vater und mein Bruder unseren durch die Druckwelle einer Luftmine umgestürzten Kleiderschrank, bauten so ein Versteck, in dem sie verschwanden, wenn die Gestapo in der Nähe war.“
In das ramponierte Haus wird von den Behörden eine weitere jüdische Familie eingewiesen: „Ich erinnere mich an den Nachnamen, Winter“, sagt Till Heidenheim. Nach dem Krieg träumt er noch jahrelang von den großen Teppichen, die als Raumteiler in der halbzerstörten Wohnung aufgehängt wurden. „Das hat meinen Alltag monatelang geprägt.“
Dieser Alltag in den Monaten vor Ende des Krieges ist für Familie Heidenheim weiterhin voller Gefahren. Zum einen droht ständig die Entdeckung des Verstecks von Vater Hans und Sohn Hannes. Zum anderen wird Gerresheim von den Alliierten bombardiert. Mutter Maja, Schwester Helga und Till suchen Schutz im eigenen Keller, denn durch ihren Status als Juden ist ihnen die Nutzung der städtischen Luftschutzkeller verboten. Die beiden im ersten Stock Versteckten können nur hoffen, dass das Haus verschont bleibt. Einmal, als eine Bombe die Gärten der Nachbarn trifft, entgehen sie knapp dem Tod.
Nach der fingierten Flucht bekommt die Familie für den Vater keine Lebensmittelkarten mehr. Die Nahrungsmittel werden knapp. „Zum Glück wurden wir von außen unterstützt, durch einen Pater aus dem Franziskanerkloster. Dort gab es ja einen eigenen Obst- und Gemüsegarten. Manchmal habe ich einen Mönch mit brauner Kutte und großer Kapuze bei uns gesehen. Dass der unter seiner weiten Kleidung Essen geschmuggelt hat, habe ich als Zwölfjähriger nicht mitbekommen, und das sollte wohl auch so sein.“ Als jüngster wird Till Heidenheim von seiner Mutter bewusst weniger in die Geschehnisse eingebunden als die Geschwister: Sie sorgt dafür, dass er selten zuhause und so oft wie möglich mit Siggi und den wenigen anderen Kindern, die noch mit ihm spielen durften, im Grafenberger Wald unterwegs ist. „Hätte mich die Gestapo bei uns angetroffen und verhört, so hätten die durch geschickte Fragen sicher etwas aus mir herausholen können.“
Durch seinem Bruder Hannes erfährt Till Heidenheim Jahre später, dass sogar der berüchtigte Gestapo-Beamte Georg Pütz höchstpersönlich zu einem Kontrollbesuch an der Friedingstraße vorbeischaut: „Meine damals 17-jährige Schwester Helga war allein in der Wohnung. Pütz stellte ihr eine Fangfrage, wollte meinen Vater sprechen, aber Helga hat sich sehr clever verhalten, die Naive gespielt und gesagt, sie wisse nicht, wo er sei.“
Rund ein halbes Jahr später geht der Krieg in Düsseldorf zu Ende – etwas früher als in anderen deutschen Städten. In den Wochen zuvor haben die Amerikaner die Stadt vom bereits eingenommenen linken Rheinufer aus unter Beschuss genommen. Um eine geplante Bombardierung zu verhindern und Düsseldorf kampflos zu übergeben, nimmt eine Widerstandsgruppe um den Rechtsanwalt Karl August Wiedenhofen, den Oberstleutnant Franz Jürgens und den Architekt Aloys Odenthal, der letztere ein Gerresheimer Freund und Nachbar der Heidenheims, am 16. April 1945 Kontakt zu den alliierten Truppen auf. Die „Aktion Rheinland“ erreicht das gewünschte Ziel: Wiedenhofen und Odenthal fahren am Tag darauf auf den amerikanischen Panzern mit und leiten sie zum Polizeipräsidium. Der Mut der Gruppe fordert Opfer: Jürgens und vier weitere Mitstreiter sind da bereits in einem Standgerichtsverfahren wegen Verrats verurteilt und von den Nazis erschossen worden.
Familie Heidenheim erlebt den Einmarsch der Amerikaner, die sich von Mettmann aus am 17. April 1945 durch Gerresheim dem Stadtzentrum nähern, vor Ort. „Meine Schwester Helga kam nach Hause und fragte, ob wir den Lärm hören würden, da führen lauter Panzer von der Hardt die Benderstraße runter, und auf denen stünde u-sa.“ Helga spricht den ihr unbekannten Aufdruck „USA“ deutsch aus, in zwei Silben und mit der Betonung auf dem U. „Darüber haben wir uns später noch oft amüsiert.“ Maja Heidenheim begibt sich mit Helga und Till sofort zu den anderen Bürgern an den Straßenrand, ein weißes Betttuch schwenkend. „Meine Mutter, die gut Französisch aber kaum Englisch konnte, hat immer wieder very nice gerufen, und Helga und ich haben es ihr nachgetan. Very nice, very nice, very nice.“
Als klar ist, dass die Amerikaner die Stadt übernehmen, trauen sich Vater Hans Heidenheim und Sohn Hannes offen aus ihrem Versteck – erstmals seit fast neun Monaten. „Mein Vater trat auf die Straße und küsste vor Erleichterung den Bürgersteig vor dem Haus. Und auf einmal kamen an der Friedingstraße die Nachbarn auf uns zu, die uns vorher verhöhnt hatten und deren Kindern der Kontakt zu mir verboten gewesen war. Und dann hieß es plötzlich: Ach, Herr Heidenheim, Sie leben ja noch, wie schön.“
Till Heidenheim beschreibt seinen Vater rückblickend als jemanden, der stets zu Scherzen aufgelegt war und versuchte, auch in der schlimmsten Not an das Positive zu denken. „Nach dem Motto, es geht immer irgendwie weiter.“ Dazu passt das Finale der Anekdote: Hans Heidenheim löst die Situation auf, indem er lächelnd auf den Fieseler Storch verweist, der kurz zuvor auf einer Wiese in der Nähe gelandet ist. Mit diesem Leichtflugzeug sei er eben erst in Gerresheim angekommen. „Die Nachbarn haben das sogar geglaubt.“
In den Wochen nach der Befreiung gibt es in der zuvor systemtreuen Nachbarschaft so einige, die Hans Heidenheim um einen Persilschein bitten – ein Schreiben, das bescheinigt, dass sie immer gut zu den Heidenheims gewesen seien, trotz des Wissens um deren jüdische Abstammung. „Mein Vater war so glücklich, dass er lebte und dass Krieg und Naziherrschaft vorbei waren, dass er ihnen den Gefallen getan hat. Diese Größe hat mir die Verpflichtung auferlegt, die Geschichte unserer Familie zu erzählen, solange ich lebe.“
Obwohl der Krieg vorbei ist, geht für den jungen Till Heidenheim die Ausgrenzung weiter. Nachdem durch die Kriegsfolgen in Düsseldorf 1945 und 1946 der Unterricht ruht, meldet ihn sein Vater als einen der ersten Schüler überhaupt am Gymnasium Gerresheim an. Damals ist es noch nicht an der Adresse Am Poth (seit 1957), sondern im Gebäude der heutigen Förderschule an der Schönaustraße untergebracht. Mangels Alternativen besteht nach dem Krieg ein Großteil der Lehrerschaft aus ehemaligen NSDAP-Mitgliedern. „Mein Klassenlehrer hat mich nach Strich und Faden schikaniert. Dass er ein Gerresheimer Nazi war und über den jüdischen Hintergrund meiner Familie genau Bescheid gewusst haben dürfte, ist mir erst viel später durch die Forschungen von Jürgen Tenbrock bekannt geworden.“
Nachdem er auch noch von einigen Mitschülern gemobbt wird, wechselt der 16-jährige Till 1948 auf das Görres-Gymnasium an der Königsallee. Durch die Diskriminierung im Schulsystem der Nazis fehlen ihm die altsprachlichen Grundlagen. Dennoch beißt er sich durch – und freut sich, dass er nach dem Unterricht seinen nur 500 Meter entfernt arbeitenden Vater besuchen kann. Der baut als Geschäftsführer an der Graf-Adolf-Straße im Auftrag der britischen Militärregierung Düsseldorfs zweitgrößtes Kino neu auf – den Europa-Palast, der sich in dem Block befindet, wo später das Warenhaus Horten eröffnet und heute Edeka Zurheide residiert.
Ende 1949, zwei Monate nach der offiziellen Neu-Eröffnung des bis dahin provisorisch betriebenen Kinos, stirbt Hans Heidenheim mit nur 62 Jahren. „Ich habe meinen Vater sehr geliebt, und ich vermisse ihn bis heute. Sein viel zu früher Tod war sicherlich auch eine Folge der erlittenen Strapazen. Auf früheren Fotos kann man erkennen, dass mein Vater ein wohlbeleibter Mann war. Zu Kriegsende war er total abgemagert, und er hat sich körperlich nie richtig erholt.“
Nach dem Tod des Vaters orientiert sich Till Heidenheim ebenfalls Richtung Filmbranche. Zunächst absolviert er eine Lehre als Filmkaufmann bei der Eagle Lion Film, dem ersten, von den Briten initiierten Filmverleih der Stadt nach dem Krieg. Als 19-Jähriger schließt er 1951 noch eine verkürzte technische Lehre an – im Hadeko-Filmkopierwerk in Neuss, das von Gustav Heidenheim geführt wird, seinem fast 20 Jahre älteren Halbbruder aus der ersten Ehe des Vaters. „Gustel war vor den Nazis nach Frankreich geflohen und hatte in Belgien, Holland sowie in Paris als Filmcutter gearbeitet. Als die Wehrmacht das Land überfiel, ging er in den Widerstand, wurde gefangen genommen, im Lager Gurs interniert und schließlich nach Buchenwald deportiert.“
Im Buchenwald kommt es zu einem tragischen Familientreffen: Gustav Heidenheim merkt, dass zeitgleich auch Walter Heidenheim im KZ einsitzt. „Wie wir heute wissen, ist Walter bei seiner Flucht in die Schweiz festgenommen worden. Die Schweizer haben nicht alle deutschen Juden ins Land gelassen, und Walter war einer von denen, die über Österreich zurück an die deutschen Behörden überstellt wurden. Jürgen Tenbrock hat Unterlagen gefunden, nach denen anschließend die Bürokraten der Gerresheimer Gestapo dafür gesorgt haben, dass Walter nach Buchenwald geschickt wird.“
Während er von seinem „Lieblingsbruder“ Walter erzählt, klingt Till Heidenheims Stimme belegt. Die Last der Vergangenheit: „Als kleiner Junge konnte ich nicht verstehen, warum Walter Düsseldorf 1944 so plötzlich verlassen hat. Ich war zu jung, um nachzuvollziehen, dass er Angst vor der Gestapo hatte und dass sie ihn abtransportieren und ins KZ schicken.“
Gustav Heidenheim (gestorben 1977) überlebt Buchenwald und wird von den Amerikanern aus dem KZ befreit. Nach dem Krieg recherchiert Maja Heidenheim das Schicksal ihres Sohnes Walter: „Demnach ist mein Bruder wohl Anfang 1945, also mit 19 Jahren, auf einen der Todesmärsche von Buchenwald nach Bergen-Belsen geschickt worden. In den dortigen KZ-Akten wurde er nicht als Zugang verzeichnet, daher müssen wir davon ausgehen, dass er den langen Fußmarsch gen Westen nicht überlebt hat.“ Till Heidenheim hält inne, schluckt. Dann spricht er weiter: „Walter war der schüchternste und körperlich schwächste von uns Brüdern. Über sein Schicksal nichts Genaueres zu wissen – das hat mich noch jahrzehntelang gequält.“
Im „entnazifizierten“ Düsseldorfer Nachkriegsalltag hätten die Heidenheims nicht wenigen begegnen können, die während des Dritten Reichs zu Tätern wurden: Georg Pütz – der „Exekutivbeamte“ im „Judenreferat“ der Düsseldorfer Gestapo, der Maja und Helga Heidenheim verhört hat – taucht zunächst unter, wird dann festgenommen und zu acht Jahren Gefängnis verurteilt. Obwohl er als Judenhasser bekannt ist und an allen Düsseldorfer Deportationen in die KZs beteiligt war, kommt er 1952 auf Bewährung frei. Danach bleibt ihm der Polizeidienst verwehrt, ansonsten lebt er unbehelligt bis zu seinem Tod. Auch sein zeitweiliger Chef, der Polizeirat Wilhelm Friedrich, als Leiter des „Judenreferats“ federführend bei allen regionalen Deportationen der Jahre 1941 und 1942, kommt nach dem Krieg mit einer geringen Haftstrafe davon. Nach drei Jahren ist er ein freier Mann.
Till Heidenheims Mutter Maja (gestorben 1978) ist neben ihrem Mann Hans auf dem Gerresheimer Waldfriedhof begraben – dort, wo dieser während der NS-Zeit Zwangsarbeit leisten musste. Schwester Helga (gestorben 2016) heiratet nach dem Krieg, arbeitet als Disponentin für einen Düsseldorfer Filmverleih und zieht später wie Till nach Norddeutschland. Bruder Hannes (gestorben 2007) wird ein weltweit geschätzter Künstler und Galerist, bekannt als Hanns H. Heidenheim (seine Vita ist im eMuseum Düsseldorf einsehbar). Er reist viel, gründet den Verlag Ursus-Presse, beschäftigt sich intensiv mit dem Judentum und wird von Max Brod für seine Holzschnitte gelobt. Mehrere seiner Werke hängen heute in Till Heidenheims Lübecker Wohnung. „Auf einem ist der Düsseldorfer Hofgarten verewigt.“
Till Heidenheim entwickelt nach der von ihm initiierten Stolpersteinverlegung vor seinem Elternhaus ein neues, positives Verhältnis zu Gerresheim. Mit dem Düsseldorfer Historiker Peter Henkel besucht er 2014 gemeinsam die drei Gebäude, in denen er einst in Gerresheim zur Schule ging. Er frischt alte Bekanntschaften auf, wird Mitglied im Bürger- und Heimatverein, lernt neue Freunde kennen und bleibt in Kontakt. 2022 hält er auf Einladung von Jürgen Tenbrock, Geschichts- und Erdkundelehrer am Gerresheimer Gymnasium, auf der Feier zum 75-jährigen Schul-Jubiläum eine Rede, erzählt die Geschichte seiner Familie – als Ehrengast der Stadt, in Anwesenheit des Bürgermeisters Josef Hinkel.
Siegfried „Siggi“ Krüger (91) wohnt immer noch in der alten Nachbarschaft. Nach dem Krieg hatten sich er und Till Heidenheim aus den Augen verloren. Durch die Stolpersteine sind sie wieder zusammengekommen und haben sich mehrmals in Gerresheim getroffen. „Wir konnten uns noch gut an gemeinsame Erlebnisse erinnern, zum Beispiel wie wir am Weiher im Ostpark Ruderboote ausgeliehen oder in der Düssel gebadet und Stachelditzkes gefangen haben.“

Auch ein Jungensstreich, dessen Gefährlichkeit ihnen damals kaum bewusst war, kommt den alten Freunden wieder in den Sinn: „Das dürfte so um 1943 rum gewesen sein“, erzählt Till Heidenheim, „mitten im Winter, alles war weiß.“ Ort des Geschehens: die bis heute bestehende Pfeiffer-Brücke, die sich über die Ludenberger Straße zum Grafenberger Wald spannt. „Unter uns fuhr ein Militärtransport entlang. Siggi und ich haben von oben Schneebälle auf die Fahrzeuge geworfen, und dabei habe ich eine Windschutzscheibe getroffen, was natürlich sofort aufgefallen ist. Danach sind wir schnell weggelaufen und haben uns versteckt. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn die Soldaten die Böschung emporgestiegen und uns geschnappt hätten. Für meine Familie hätte das böse enden können …“
Bis heute halten die beiden Kindheitsfreunde telefonisch Kontakt und ergänzen gegenseitig alte Erinnerungen. Ein – so nennt sich Till Heidenheim augenzwinkernd – „gelernter Norddeutscher“ und sein alter Weggefährte aus Gerresheim. Nur ein paar Tage vor dem Interview haben sie sich noch unterhalten. „Ich verabschiede mich dann immer mit Tschüss, das habe ich mir nach mehr als 50 Jahren außerhalb Düsseldorfs angewöhnt – und Siggi sagt Tschö, wie damals.“
Weiterführende Informationen
Till Heidenheims ehemalige Volksschule an der Benderstraße 78 heißt seit 2003 „Hanna-Zürndorfer-Grundschule“, benannt nach der ebenfalls aus Gerresheim stammenden Jüdin Hanna „Hannele“ Zürndorfer (hier ein Video von ihrem Schulbesuch 2008). Diese wohnte nur wenige Straßenzüge von den Heidenheims entfernt, an der Sonnbornstraße. Auch vor ihrem ehemaligen Elternhaus sind 2004 zwei Stolpersteine verlegt worden. Sie erinnern an Zürndorfers Eltern Elisabeth und Adolf, die im Oktober 1941 von Düsseldorf aus ins Ghetto Litzmannstadt (Łódź) deportiert wurden. Der Vater verstarb dort 1942, die Mutter wurde im gleichen Jahr im KZ Chelmno ermordet.
Hanna Zürndorfer und ihre Schwester Lotte waren von ihre Eltern 1939 mit dem letzten „Kindertransport“ nach England geschickt worden. Zürndorfer heiratete, nutzte fortan ihren zweiten Vornamen und wurde als Karola Regent in England Journalistin. Am 1. Dezember 2023 ist sie in Schottland mit 98 Jahren gestorben. Ihre Erinnerungen an die NS-Zeit und die ersten Jahre in der neuen Heimat hat sie in einem sehr lesenswerten Buch festgehalten: „Verlorene Welt“. Im Friedrich-Verlag ist eine verkürzte, für den Schulunterricht bestimmte Version erschienen (vergriffen). Das Original (200 Seiten) ist antiquarisch im Netz zu finden. Auf dem YouTube-Kanal der Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf sind zudem drei als Hör-Version eingesprochene Folgen mit Erinnerungen von Hannele Zürndorfer abzurufen und zwar hier.
Im letzten Kapitel von „Verlorene Welt“ ist auch kurz von Till Heidenheims Vater Hans die Rede. Zürndorfer zitiert aus einem Ende 1945 an sie gerichteten Brief von Hella Röttger, der Ehefrau des 1942 verstorbenen Gerresheimer Schriftstellers Karl Röttger. Hintergrund: Die gegen die NS-Diktatur eingestellte Familie Röttger wohnte ebenfalls an der Friedingstraße und kannte neben den Zürndorfers auch die Heidenheims persönlich. Das auf Englisch geschriebene Buch von Hannele Zürndorfer wurde für die 1988 erschienene deutsche Ausgabe von einer Tochter Karl Röttgers übersetzt. Nach Karl Röttger ist heute ein Platz in Düsseldorf-Mörsenbroich benannt.
Das erwähnte Zitat lautet: „(…) Erinnert Ihr Euch noch an Herrn Heidenheim, der unten in der Friedingstraße wohnte? Er sollte im September 1944 noch verschickt werden, hat sich aber bis zur Befreiung unserer Stadt am 17. April 1945 in seiner Wohnung verborgen gehalten. Kein Mensch hat etwas bemerkt. Bei den schweren Bombenangriffen und bei der Artilleriebeschießung mußte er allein der Wohnung bleiben. Das Haus wurde schwer beschädigt, aber er blieb gesund …“
Quellen bei der Recherche (neben dem Interview mit Till Heideheim) u.a.:
Jürgen Tenbrock: „Leidensgeschichte einer Familie: die Heidenheims“ (Artikel im Stadtteilmagazin Gerrikuss, Nr. 4/2022, Hg.: Hanno Parmentier & Peter Stegt)
Bastian Fleermann, Hildgard Jakobs, Frank Sparing: „Die Gestapo Düsseldorf: 1933-1945“, Kleine Schriftenreihe der Mahn- und Gedenkstätte (Band 1) Droste-Verlag 2012
Bastian Fleermann, Hildegard Jakobs: „Herrschaft der Gewalt: Die nationalsozialistische Machtübernahm in Düsseldorf.“ (gleiche Reihe, Band 2)