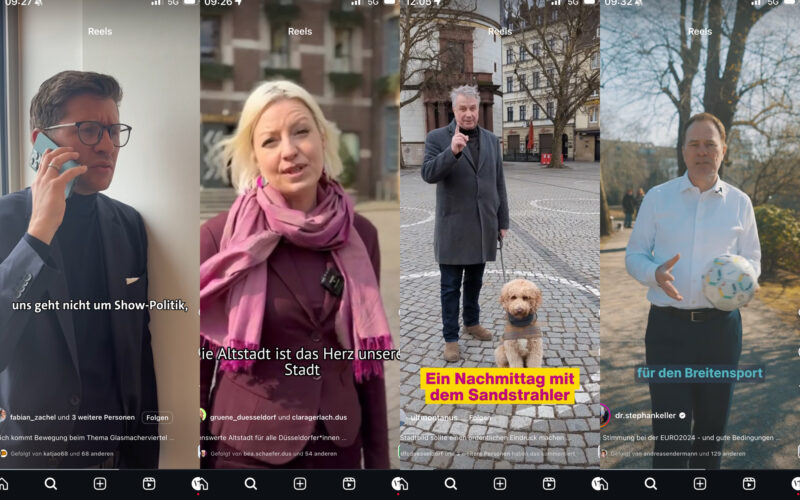Prügel vom Herrn Pastor

Seinen Namen will ich nicht nennen. Zuviel der Ehre. Außerdem verstoße ich hier gegen die Regel „Über die Toten nichts Schlechtes“. Für uns hieß und war er nur der „Herr Pastor“. Zuständig für ein Dorf, nur ein paar Minuten von Düsseldorf entfernt, wohnte er im mächtigen Pfarrhaus neben der Kirche, mit einer Haushälterin, die wir allerdings nie kennenlernten. In der Schule mitten im Ort unterrichtete er, vermutlich nannte man das Fach Religion. Katholisch zu sein war dort und damals der Normalfall. Alternativen waren uns, den Kindern zwischen sechs und zehn Jahren, nicht bekannt. Den Begriff „Protestant“ hörte ich erst Jahre später.
Das ist jetzt eine gemeine Stelle, den Text auszublenden, das wissen wir.
Unser Journalismus ist werbefrei und unabhängig, deshalb können wir ihn nicht kostenlos anbieten. Sichern Sie sich unbegrenzten Zugang mit unserem Start-Abo: die ersten sechs Monate für insgesamt 1 Euro. Danach kostet das Abo 10 Euro monatlich. Es ist jederzeit kündbar. Alternativ können Sie unsere Artikel auch einzeln kaufen.
Schon Mitglied, Freundin/Freund oder Förderin/Förderer?