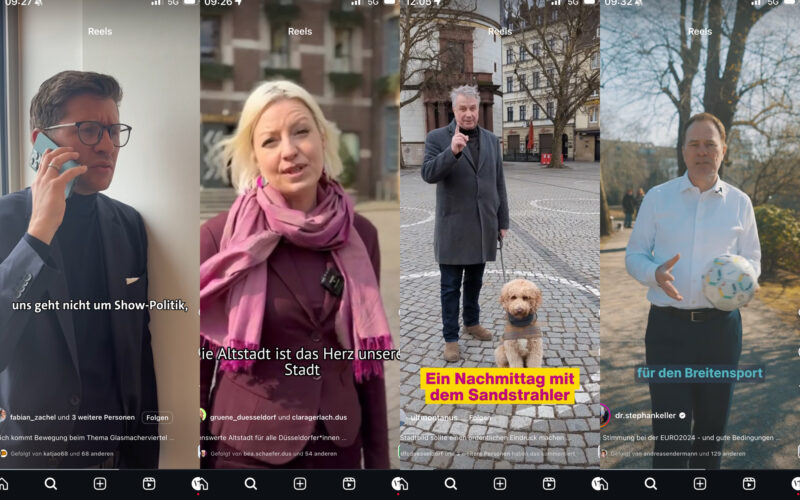Rundgang mit Peter Doherty: “Meine Ziele? Hm. Ein paar Pfunde abnehmen?“
Ich wusste von ihm nur, was alle wissen: Dass er Rockmusiker ist. Dass er mit dem Supermegatopmodel Kate Moss zusammen war. Dass er alle Drogen, die er in die Finger bekam, konsumiert haben soll, was ihm eine Menge Scherereien einbrachte, zum Beispiel mit seinen Bands (den „Babyshambles”, gibt es immer noch, und „The Libertines”, gibt es nicht mehr) und mit der Polizei. Im Grunde mit allen. Skandalrocker hat man ihn genannt.
Und nun war Peter Doherty in Düsseldorf. Der 1979 geborene Brite, der mittlerweile in der Normandie leben soll, ist nicht nur Rockmusiker und bricht zuweilen nachts besoffen in einen Musikladen ein, um eine Gitarre und eine Schallplatte zu klauen (so geschehen 2011 in Regensburg). Er zeichnet auch und fertigt wilde Collagen an. Darum hatte ihn das NRW-Forum eingeladen, neben anderen Prominenten an der Ausstellung „Beyond Fame” teilzunehmen. Sie zeigt Kunstwerke von bekannten Menschen, die nicht als Künstlerinnen oder Künstler bekannt wurden, sondern als Politiker (Anton Hofreiter), Schauspielerin (Meret Becker), Wimbledonsieger (Michael Stich), Werbekoryphäe (Jean-Remy von Matt), Modefreak (Harald Glööckler) oder eben Skandalrocker.
Ich kam am Eröffnungstag gegen fünf im NRW-Forum an. Da war es noch einigermaßen leer. Seelenruhig schlenderten ein paar Promis durch die Räume. Hätte mir ein Bekannter nicht zugeraunt, guck mal, da hinten, Peter Doherty, ich hätte ihn nicht erkannt. Im Kopf hatte ich die Bilder, die vor Jahren durch die Medien geisterten und auf denen Doherty immer fahl und verschwitzt aussah, dazu dieser fahrige, kalte Junkieblick. Jetzt aber spazierte da hinten ein stattlicher, wohlbeleibter Herr im grauen Anzug, mit grauer Schiebermütze auf dem Kopf und mit einer fast schon buddhahaften Ausstrahlung, selbst von hinten. Ich sprach ihn an.
„Peter, hast du Ziele im Leben?”, fragte ich. Wie ich darauf kam – ich habe keine Ahnung. Doherty sah mich an, als überlegte er: Was ist denn das für eine bescheuerte neoliberale Frage. Er rückte seine Mütze zurecht. Seine grauen Haare waren verschwitzt. Die 44 Jahre sah man ihm nicht an. Er wirkte älter. Auch als Landschlossbesitzer im 19. Jahrhundert hätte er eine gute Figur gemacht. In der Brusttasche seines Sakkos steckten drei Zigaretten, Filter nach oben. Anstelle einer Antwort fragte er zurück (wir sprachen Englisch miteinander): Ob es mir etwas ausmachen würde, mit ihm durch die Ausstellung zu gehen.
Und so zogen wir los, begleitet von Dohertys sanftmütig trottender Mischlingshündin Gladys. 56 Kilogramm schwer und wie ihr Herrchen von der Aura umgeben, alle Schlachten im Leben geschlagen zu haben. Wir zogen los und schwiegen und gingen weiter und weiter, Doherty voran, die Hündin daneben, ich hinterher. Einmal blieb Doherty stehen, um mir zu sagen, dass ihm die Kunst von Lea Draeger, der Schauspielerin, gut gefalle. Draeger hatte die Wände eines Raums mit hunderten von kleinen, kachelartigen Schwarz-Weiß-Bildern vollgehängt.
Wir langten am Ende eines Ganges an. Doherty machte kehrt und ging stumm an mir vorbei, als stünde ich gar nicht da. Da bat ihn ein Fotograf, ein Bild machen zu dürfen. Der Musiker nickte. Die ganze Zeit über verzog er keine Miene. Immer derselbe neutrale Gesichtsausdruck. Je länger ich ihn ansah, desto stärker erinnerte er mich an den Schauspieler Wagner Moura in seiner Rolle als Drogenbaron Pablo Escobar in der Netflixserie Narcos. Die gleiche Statur. Das gleiche weiche, rundliche Gesicht. Der gleiche Schnäuzer. Die gleiche unerschütterliche Selbstsicherheit, eine sehr attraktive Eigenschaft. Leider bekommt man sie, glaube ich, nicht geschenkt im Leben. Wahrscheinlich muss man einiges dafür abgeliefert haben. Im nächsten Moment trat Dohertys Frau zu uns. Sie heißt Katia de Vidas und ist Keyboarderin In der Band „Peter Doherty and The Puta Madres”. (Puta – eines der Lieblingsworte vom Netflix-Pablo-Escobar.) Das Paar hat eine drei Monate alte Tochter (aus einer früheren Beziehung hat Doherty bereits einen 20-jährigen Sohn), und de Vidas war gerade dabei, sie zu stillen. Für das Foto stellte sie sich neben ihren Mann, wie selbstverständlich das trinkende Baby an der Brust. Einer katholischen Kirchenzeitung wird der Fotograf das Bild eher nicht verkaufen können.
Danach stellte ich Doherty meine Frage erneut. Er sah in eine unbestimmte Ferne und sagte, hm, er sollte wohl eigentlich Ziele haben, doch falle ihm gerade keins ein. Er tätschelte sich den Bauch. „Vielleicht ein paar Pfunde abnehmen?”
Als Nächstes fragte ich: „Weißt du schon, was du nachher spielst?” (Doherty gab an dem Abend ein kleines Konzert im Ehrenhof) Er verneinte. Er werde auf die Bühne gehen, und dann, tja – mal schauen.
Daraufhin sah er mich an und fragte: „Hast du Ziele?” Ich habe einige, nannte ihm aber nur zwei, die ich halbwegs erreichbar finde. Doherty sah mich an, als hätte ich verkündet, im Champions-League-Finale für Real Madrid das Siegtor schießen zu wollen, und sagte: „Good luck.” Anschließend dachte ich: Doherty hat natürlich vollkommen recht. Dieses ständige Zielesetzen, das einem in unserer sogenannten Leistungsgesellschaft an jeder Ecke als unverzichtbar angedreht wird, es ist absolut albern. Es führt zu gar nichts, höchstens dazu, dass man sich ein neues setzt, wenn man gerade eins erreicht hat. Also besser gar nicht erst damit anfangen. Abnehmen wollen würde ich als Ziel durchgehen lassen. Für mich kommt es nicht in Frage, denn dafür müsste ich erst einmal zunehmen.
Nach dem Gespräch verbrachte ich noch eine Zeitlang in dem Raum, wo die Werke von Doherty hängen. Die Ausstellungsmacher hatten allen Promis einen Fragebogen vorgelegt. Die Fragen und Antworten sind auf großen Tafeln gleich neben den ausgestellten Werken zu lesen. Auf die Frage, was ihn inspiriert, antwortete Doherty: „Im Moment inspiriert mich die Sonne. (…) Manchmal fahre ich in meinem Twingo mit meinen beiden Hunden durchs Land, scheinbar ziehe ich daraus unermessliche Inspiration.” Ein schönes Bild, oder? Der Twingo. Die Landschaft. Die Hunde. Doherty am Steuer. Vielleicht, auch wenn es nur aus Worten besteht, das schönste im ganzen Raum.
Tatsächlich gab Doherty an dem Abend nicht ein Konzert, sondern zwei. Das zweite war das eigentliche. Es ging draußen im Abendsonnenlicht über die Bühne, vor Hunderten von Ausstellungsgästen. Doherty kletterte auf die Bühne, leerte seine Flasche Bier, nahm einen letzten Zug aus der Zigarette, ließ die Kippe in die Flasche fallen, hängte sich seine akustische Gitarre um und spielte und sang. Alles eine einzige fließende Bewegung. Der Mann kann ja was als Musiker, das vergisst man leicht bei all dem Drumherum, mit dem er von sich reden gemacht hat. Das andere gab er kurz nach unserem Gespräch. Einfach so, aus Fun, vielleicht war es auch ein Soundcheck. Plötzlich stand er auf der Bühne und spielte ein paar Songs, mit einer Selbstverständlichkeit, mit der sich unsereins höchstens die Schuhe zubindet. Eine Szene wie bei einer Supermarkteröffnung. Kaum jemand bekam es mit, vielleicht acht, neun Leute, darunter eine alte Frau mit Rollator. Sie sah lange zu Doherty hin. Er erwiderte ihren Blick. Dann zuckelte die Frau weiter.