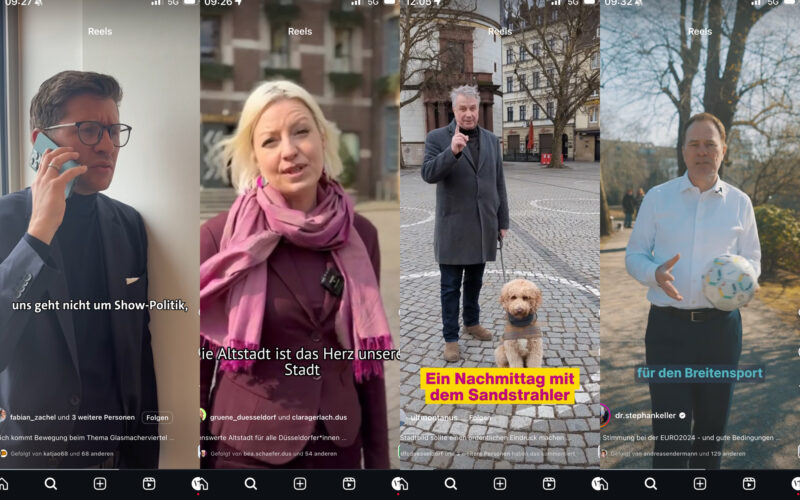Wo Steine Geschichten erzählen
Auf dem Nordfriedhof nahe des Eingangs Thewissenweg gibt es diesen kleinen, schneeweißen Grabstein, der mich stets besonders berührt. Oft stehen frische Blumen darauf, saubere Kiesel umrahmen ihn, er wird sorgfältig gepflegt. Über 40 Jahre ist er alt, und am eingravierten Geburts- und Todesdatum wird klar: Dort wurde damals ein Kind beerdigt, ein Mädchen. Heute wäre es eine Frau von Mitte 40, womöglich selbst Mutter. Gesehen habe ich die Eltern nie, obwohl ich häufig da war. Gerne hätte ich mit ihnen gesprochen. Was hat dieses Paar erlebt in dieser Zeit, wie ist es mit dem Verlust des Kindes umgegangen, ist es jemals damit fertig geworden? Der Zustand des Grabes lässt daran zweifeln. Über die vielen Jahre wurde die Erinnerung an die Tote am Leben erhalten. Traurig? Oder schön? Wer weiß.
Berührend auch die Menschen, die über die Wiese mit den anonymen, unsichtbaren Gräbern gehen, sichtlich suchend, oft eine Blume, ein Grablicht oder eine Engelsfigur in der Hand. Sie wissen, irgendwo hier muss der oder die Betrauerte liegen. Gern würden sie ihr Geschenk ablegen, aber sie wissen nicht wo. Also bleibt es, wo schon Dutzende andere liegen. Diesen Menschen fehlt der Ort zum Trauern, und womöglich bedauern es manche von ihnen, seinerzeit zugestimmt zu haben, als es um die Art der Bestattung ging und man sich für eine billige Lösung ohne nachträgliche Verpflichtung entschieden hat.
Wie ihnen geht es sehr vielen: Auf den dort liegenden, langen Granitplatten am Rand der Wiese sind hunderte Namen eingraviert, die Fläche ist groß, es ist noch viel Platz für viele weitere. Nichts verweist auf eine der Urnen, die in der Nähe begraben worden sind. Denn das ist der Plan. Es soll kein Grab geben, um das sich jemand kümmern müsste.
Der Name dessen, dem ich dort immer eine Blume hinlege, ist für mich leicht zu finden, denn er steht zufällig oben an erster Stelle auf diesem schwarzen Stein. Im Leben haben wir uns nicht verstanden, er mochte mich nicht, und umgekehrt. Aber nun finde ich: Das ist vorbei, auch er bekommt von mir mein Gedenken. Unser Streit war in einer fernen Vergangenheit. Buchstäblich beerdigt, und zwar schon lange.
Zeit spielt für die Menschen, die dort liegen, eh keine Rolle mehr. Daran könnte man sich ein Beispiel nehmen, in Ruhe anschauen, was in die Steine eingemeißelt wurde. Und so Geschichten finden, die diese stummen Zeugen erzählen. Das Ohr ist dabei allerdings sinnlos, man erkennt sie nur mit dem Auge, muss sie sich aufgrund der Zahlen und Namen zusammenreimen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Wie die auf den Doppelgräbern von Ehepaaren. Lange haben sie offenbar zusammengelebt, und so zeigt mancher Grabstein, dass der Tod eben nicht das Ende einer lebenslangen Beziehung sein muss. Binnen weniger Tage sind beide gestorben, der Zurückgebliebene konnte ohne den anderen nicht sein. Oder wenn klar wird, dass Kinder vor ihren Eltern gehen mussten. Nun liegen sie in einem Grab, die Familie ist wieder vereint, und man ahnt, was da über die Jahre geschehen ist. Verwaiste Eltern, junge Witwen, junge Witwer – der Tod schreibt berührende Stories und lässt Raum für absolut sicher kommende Fortsetzungen. Nämlich dann, wenn ein paar Namen aufgeführt sind mit Geburts- und Todestag, und andere bereits eingemeißelt, neben denen der Platz für das Datum des letzten Stündleins aber noch frei ist. Das werden manche beklemmend finden, andere sehen es pragmatisch: Da der Steinmetz ohnehin bei der Arbeit war . . .
Dass Humor in unserer Begräbniskultur vorkommt, ist eher selten. Woanders gibt es ihn. Nahe Malaga sah ich das Grab eines Deutschen, das über und über mit Bierkrügen geschmückt war. Und im Norden fiel mir diese Inschrift auf: „Ich wär‘ jetzt auch lieber auf Sylt“ stand auf einem dieser typischen abgerundeten Findlinge, die man auf den Nordsee-Inseln gern als Gartendeko nutzt. Nun wurde er zum Grabstein, und liegt nicht weit vom Eingang des Friedhofs in Hamburg-Bergedorf.
Vieles, jedoch nicht alles ist aus den Steinen zu lesen. Aber jeder, der auf dem Friedhof die Gräber von Angehörigen und Freunden besucht, weiß um das, was sich hinter den dürren Zahlen verbirgt – wie diese Geschichte eines merkewürdigen Zufalls: Die Inschrift auf dem Grabstein des leitenden Redakteurs eines Düsseldorfer Medienhauses macht klar, wie viele Jahre seine Frau vor ihm starb. Gekannt habe ich ihn nicht, aber seinen Namen mehrfach gehört. Zwei seiner Nachfolger im Amt erlebten das gleiche, sie mussten ihre Ehefrauen beerdigen. Ich weiß das. Mit dem einen habe ich lange zusammengearbeitet, der andere bin ich selbst. Namen nenne ich hier nicht. Denn die Toten können nicht mehr zustimmen, daher wäre das respektlos.
Ein anderes Grab mit einem großen schwarzen Stein auf dem Nordfriedhof fällt jedem auf, der vorbei geht. Statt eines Psalms oder einem anderen besinnlichen Vers steht dort „vivere militare est“ – „Das Leben ist Kampf“. Ich habe den Mann, der dort seine Ruhestätte hat, lange gekannt. Und ich weiß, wie gern (und erfolgreich) er diesen Kampf gekämpft hat. Er war ein enger väterlicher Freund, ich vermisse ihn sehr. Seine Firma saß im Flughafen, und dort hat er beim Brand 1996 vielen im dichten Rauch herumirrenden Menschen das Leben gerettet, indem er sie ins Freie führte, denn er kannte sich aus. Dass er dabei die hochgiftigen Dämpfe des verbrennenden Kunststoffs einatmete, war ihm nicht bewusst.
Womöglich verursachten sie die Krankheit, gegen die er seinen letzten Kampf 2005 verlor.
Weiterführender Link
Im Juli habe ich über den Waldfriedhof in Meerbusch geschrieben. Meinen Text dazu lesen Sie hier.