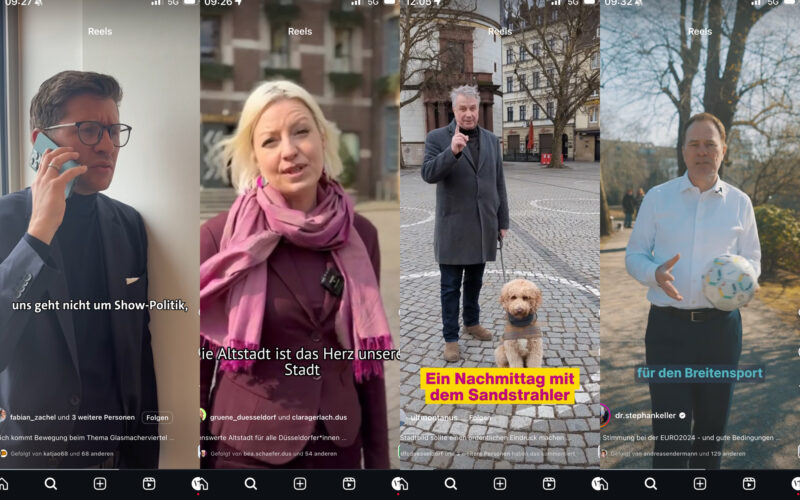Der vorerst letzte Machtkampf bei der Rheinbahn – und was er bedeutet

Die Formulierung „auf eigenen Wunsch“ sollte einen immer stutzig machen. Das gilt grundsätzlich und für die Rheinbahn noch einmal besonders. Der frühere Vorstandsvorsitzende Klaus Klar verließ das Unternehmen im vergangenen Sommer offiziell aus freien Stücken. In Wahrheit war der politische Druck so hoch, dass der Betroffene wusste, dass es nur die Wahl zwischen Rauswurf und „auf eigenen Wunsch“ hatte.
Deshalb bin ich sofort hellhörig geworden, als die „Rheinische Post“ nun berichtete, dass sich der Aufsichtsratsvorsitzende der Rheinbahn, Andreas Hartnigk, von seinem Posten zurückzieht. Offizielle Begründung ist ein „Großmandat“, das der Rechtsanwalt übernommen habe und das ihn so fordere, dass er den Vorsitz im Aufsichtsrat parallel nicht mehr schaffe. Er bleibt einfaches Mitglied des Aufsichtsrats und wird Stand jetzt auch weiter in fünf anderen Kontrollgremien sitzen (Stadtsparkasse, Messe, VRR, IPM und Holding der Landeshauptstadt).
Nach meinem Eindruck hat man ihm den Rückzug nahegelegt und damit die frühere Führungsriege endgültig ausgetauscht. Der jetzige Schritt steht deshalb für das Ende des vorerst letzten Machtkampfs bei der Rheinbahn. Das hat folgende Hintergründe:
Anfang und Aufstieg
Andreas Hartnigk ist seit vielen Jahren verkehrspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Stadtrat und deshalb auch schon lange bei der Rheinbahn politisch aktiv. Seinen wachsenden Einfluss nutzte er 2010, um Klaus Klar in den Vorstand zu bringen und zum Arbeitsdirektor zu machen. Damit hatte er einen Vertrauten dort, der in der Belegschaft beliebt war und zugleich wirkte, als könne man ihn im eigenen Sinne steuern. So wurden die beiden miteinander verbunden.
Neben Klaus Klar gab es zunächst wechselnde Vorstandsvorsitzende: erst Dirk Biesenbach, dann Michael Clausecker. Als letzterer das Unternehmen verlassen hatte, rückte Klaus Klar nach. Andreas Hartnigk hatte nun „seinen Mann“ an der Spitze. Gut eineinhalb Jahre später übernahm er im Aufsichtsrat den Vorsitz. Damit waren beide oben angekommen.
Große Nähe
Der Aufsichtsrat ist das oberste Kontrollgremium der Rheinbahn. Der Vorsitzende sollte also eine Art Chef-Kontrolleur des Vorstands sein. Diese Rollenverteilung war zwischen Andreas Hartngik und Klaus Klar schwer zu erkennen. Ich erinnere mich an eine Pressekonferenz zur Bilanz der Rheinbahn, bei der der Vorstandsvorsitzende wenig erfreuliche Zahlen präsentierte. Auf die Nachfragen verteidigte Andreas Hartnigk die Werte stärker als der Rheinbahn-Chef selbst.
Das Verhältnis zwischen den beiden kehrte sich in diesen Jahren ein gutes Stück um. Andreas Hartnigk hatte gehofft, einen strategischen Vorteil dadurch zu haben, dass sein Vertrauter das Unternehmen leitet. Mehr und mehr blieben deshalb aber auch dessen Schwächen an ihm hängen. Er musste Zahlen verteidigen, die er als Aufsichtsratsvorsitzender eigentlich kritisch zu sehen hatte, und er war offensichtlich auch bei anderen Themen nicht der kritische Gegenpart. Es gibt Hinweise, dass Klaus Klar unter fraglichen Bedingungen Berater beschäftigt und höhere Gehaltszahlungen genehmigt haben soll. Diese Vorgänge untersucht nun ein Sonderausschuss. Nach jetzigem Stand hat Andreas Hartnigk nichts davon gewusst. Das heißt zugleich aber, dass er als Kontrolleur nicht besonders gut gearbeitet hat.
Das Ende
Oberbürgermeister Stephan Keller wird immer wieder vorgeworfen, dass er nicht im Aufsichtsrat der Rheinbahn sitzt. Das wäre mit Blick auf die Verkehrswende in der Tat ein gutes Zeichen – machtpolitisch würde es aber nichts ändern. Denn spätestens im Sommer 2023 zeigte sich, wie stark der Einfluss des Rathaus-Chefs bei der Rheinbahn ist.
In dieser Zeit spitzte sich die Lage für Klaus Klar zu. Das Unternehmen entwickelte sich immer noch nicht wie gewünscht, zugleich verstärkten sich die Signale zu den fraglichen internen Entscheidungen. Das brachte Stephan Keller schließlich an den Punkt zu entscheiden, dass an der Rheinbahn-Spitze ein Wechsel erfolgen muss. Und so wurden Klaus Klar offenbar die anfangs erwähnten beiden Optionen nahegebracht. Innerhalb weniger Tage beendete er nach 47 Jahren seinen Dienst im Unternehmen.
Ähnlich scheint es nun bei Andreas Hartnigk gewesen zu sein. Bei ihm geht es zwar nicht wie bei Klaus Klar um Haftungsfragen und mögliche Rückzahlungen. Aber die Untersuchungen zu diesem Thema werden ihn voraussichtlich in keinem guten Licht erscheinen lassen. Dann wäre er als Vorsitzender des Aufsichtsrats nicht mehr zu halten. Und das hätte auch auf die CDU-Ratsfraktion und den CDU-Oberbürgermeister abgefärbt. Im Moment gab es noch die Möglichkeit, gesichtswahrend den Posten zu räumen. Deshalb soll auch in diesem Fall der Oberbürgermeister seine eindrücklichen Vermittlungskünste demonstriert haben.
Die Gewinner
Neben Stephan Keller profitieren noch zwei Akteur:innen von der jüngsten Entscheidung: Rheinbahn-Chefin Annette Grabbe und CDU-Fraktionschef Rolf Tups, der voraussichtlich nächster Aufsichtsratsvorsitzender wird.
Annette Grabbe ist seit April 2023 im Vorstand der Rheinbahn und steht seit Ende September an der Spitze. Sie verwendet nach allem, was man mitbekommt, große Kraft darauf, das Unternehmen zu verändern. Die fragwürdigen Berater gibt es nicht mehr, für wichtige Stellen wurden neue Leute geholt. Kultur und Kommunikation im Haus entwickeln sich positiv. Das alles kann in Zeiten von Fachkräftemangel und einem hohen Krankenstand bei der Rheinbahn eine wichtige Grundlage für die Verkehrswende schaffen.
Dass die Busse und Bahnen, die die Rheinbahn von den Herstellern geliefert bekommt, oft spät und/oder hochgradig mangelhaft sind, kann die Vorstandsvorsitzende nur bedingt beeinflussen. Aber je weniger Vertreter der alten Rheinbahn-Kultur noch an gut sichtbarer Stelle sind, desto leichter lässt sich die Mannschaft für neue Wege und Ziele motivieren.
Rolf Tups wäre bis vor einem Jahr noch der falsche Aufsichtsratsvorsitzende für die Rheinbahn gewesen. Damals brauchte man jemanden, der den Vorstand kritisch hinterfragt und antreibt. Das ist beim aktuellen Vorstand nicht mehr erforderlich. Er braucht vielmehr Ruhe und einen freien Rücken. Und genau dafür gilt Rolf Tups im Düsseldorfer Rathaus als der Spezialist schlechthin.
Für ihn selbst hat das eine interessante Nebenwirkung. Bisher sind die meisten davon ausgegangen, dass er mit der Kommunalwahl 2025 seinen Posten als CDU-Fraktionsvorsitzender abgibt und in die zweite Reihe tritt. Nun aber höre ich häufiger die Spekulation, dass Rolf Tups noch bis zur Mitte der nächsten Legislaturperiode als Chef weitermacht. Seine Wichtigkeit hat er nun noch einmal unverhofft unterstrichen.
Sollte so tatsächlich Ruhe einkehren und Fortschritte leichter werden, gäbe es am Ende noch mehr Gewinner: die Kundinnen und Kunden der Rheinbahn.
Weitere VierNull-Geschichten zu den Themen dieses Textes
Drei Chancen, die der Abgang des Rheinbahn-Chefs eröffnet
Über 100.000 Euro als Ratsmitglied in Düsseldorf verdient
Die Rheinbahn hat jetzt eine Chefin: Mobilität wird weiblich