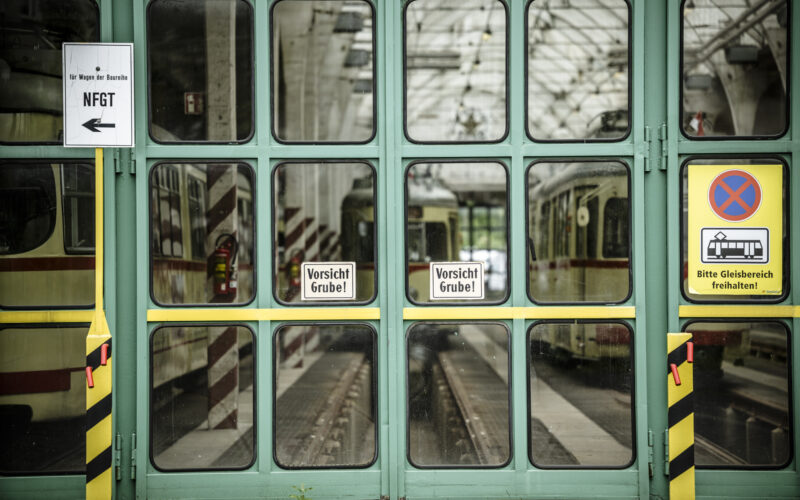Kioske breiten sich in der Düsseldorfer Altstadt immer weiter aus

Wir sind alle genervt vom Bürokratismus. Aber wer eine Verkaufsstelle eröffnen will, die man hier Kiosk nennt, hat die Sorge nicht. Das ist nämlich verblüffend leicht. Auf einer Internet-Plattform für Existenzgründer bringt man es in wenigen Sätzen auf den Punkt: „Einen eigenen Kiosk zu eröffnen, ist relativ einfach. Du brauchst keine besondere Ausbildung und musst keine Zertifikate oder Genehmigungen nachweisen. Im Grunde reicht ein Gewerbeschein, der gegen eine geringe Gebühr beim zuständigen Gewerbeamt zu beantragen ist.“
Eigentlich wäre so wenig Behördeneingriff zu begrüßen. Im konkreten Fall jedoch nicht. Denn diesen Weg gehen seit Jahren immer mehr selbst ernannte Kaufleute und lassen sich in der Altstadt nieder. In ihren Regalen stehen Hunderte Flaschen Wodka, Whisky oder andere hochprozentige Flüssigkeiten. Meist keine hohe Qualität, aber das will ja auch keiner. Bier wird ebenfalls angeboten.
Trinken auf der Straße
Anders als die in anderen Stadtteilen beliebten Büdchen, bei denen man auch zu später Stunde noch Milch, Kaffee, Nudeln oder sonst etwas kaufen kann, haben die Geschäfte in der Altstadt im Wesentlichen nur einen Zweck: die möglichst billige Versorgung der Menschen mit Alkohol. Gern wird der für vergleichsweise wenig Geld gekaufte Stoff auch fürs preisgünstige Vorglühen genutzt. In günstig angetrunkener Hochstimmung geht’s dann in Clubs und Kneipen, wo alles viel teurer ist und man nun nicht mehr so viel investieren muss, um den erwünschten Zustand erhöhter Lebensfreude zu erreichen. Dass den Gastronomen die Ausbreitung dieser Form von Konkurrenz nicht passt, liegt nahe.

Aber es geht nicht nur um Umsatz. Einige sehen auch das sich erneut verändernde Bild der Altstadt. Schließlich sind diese Läden keine Augenweide. Besonders deutlich wird das, wenn sie an sich attraktive Geschäfte ersetzen – wie jetzt vor dem Rathaus. Dort saß über die Jahre ein Anbieter namens „Geschmackssachen“. Dort konnte man Gewürze, Öle und andere Lebensmittel der nicht so weit verbreiteten Art kaufen. Anwohner glauben, dass das Geschäft wegen zu hoher Mietforderung geschlossen hat.
Das ist ein zentrales Problem, berichtete mir ein seit Jahrzehnten in der Nähe arbeitender Wirt. Die Immobilien-Eigentümer schielen aufs schnelle Geld und schließen einen neuen Vertrag mit dem zahlungskräftigeren Mieter. Dass damit langfristig der Ruf des Viertels, die Qualität des Angebots und so auch der Wert des Gebäudes nach unten geht, interessiert sie nicht. Vor allem, wenn es sich nicht um ortsansässige Personen, sondern um Firmen handelt, denen am Ende der Zustand des Stadtteils egal ist.
Eine Reihe von anderen Eigentümern, berichtete der Gastronom, hätten das Problem allerdings erkannt und weigerten sich, an Kiosk-Betreiber zu vermieten. Aber es sind zu wenige, um deren Ausbreitung zu stoppen. Das wird am Ende nur der Markt schaffen. Wächst die Zahl, dann wächst auch die Konkurrenz und damit das Risiko, pleite zu gehen. Wobei jeder natürlich hofft, er werde am Ende zu denen gehören, die es schaffen.

Zu verlangen, die Stadt müsse eingreifen, ist nutzlos. Denn das kann sie nicht. So lautet jedenfalls eine Auskunft, die mir Oberbürgermeister Stephan Keller gegeben hat, als wir über die Kioske sprachen. Die Gewerbefreiheit unterbinde den amtlichen Eingriff, die Vermieter seien frei in ihrer Entscheidung. Und wer einen Laden eröffnet, hat selbst in der Hand, was sie oder er dort verkaufen will.
Im Grundgesetz verankert
Am Ende geht es sogar um ein Grundrecht, festgelegt im Artikel 12 des Grundgesetzes. Der sagt: „Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen. Die Berufsausübung kann durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes geregelt werden.“ Damit ist auch die Freiheit des Gewerbes gemeint, sagen Juristen. Mit anderen Worten: Wer einen Laden aufmachen will, der darf das tun, wenn das jeweilige Baurecht es hergibt und er sich an andere übliche Vorgaben hält. Dazu zählen zum Beispiel Hygienevorschriften, falls offene Lebensmittel im Angebot sind.
Zwischen Stadt und Land scheint es jedoch unterschiedliche Einschätzungen zu geben, inwieweit die Kommunen Einfluss nehmen können. Das haben die Wirte bei Anfragen an die Landesregierung erfahren. Dort meint man nämlich, es gäbe für Stadtverwaltungen durchaus die Möglichkeit, für bestimmte Viertel Satzungen zu erlassen, um eine allzu hohe Anzahl von Kiosken zu vermeiden. Begründen könnte man einen solchen Schritt damit, dass mit dem vermehrten Verkauf von Alkohol eine Gefahr für die öffentliche Ordnung droht.
Dieser Ansatz ist allerdings mit einer Schwierigkeit verbunden. Es müsste sich ein klarer Kausal-Zusammenhang herstellen lassen zwischen dem Geschäftsmodell der Kioske und den in der Altstadt entstandenen Konflikten, sagen die Experten der Stadt. Das wird als extrem schwierig eingeschätzt. Düsseldorf wird daher zurzeit nichts tun wollen oder können. Denn man muss davon ausgehen, mit einem Verbot vor Gericht zu scheitern.
Fazit
Eine Lösung auf juristischem Weg ist nicht in Sicht. Die einzige Chance wäre, wenn sich Gastronomie, Einzelhandel und Immobilieneigner einigten, die Auswüchse zu beenden. Da aber etliche Eigentümer anonyme Unternehmen sind, wird es schwer sein, sie zur Kooperation zu bewegen. Am Ende muss es der Markt regeln. Wenn es zu viele Kioske gibt, graben sie sich gegenseitig den Umsatz ab.