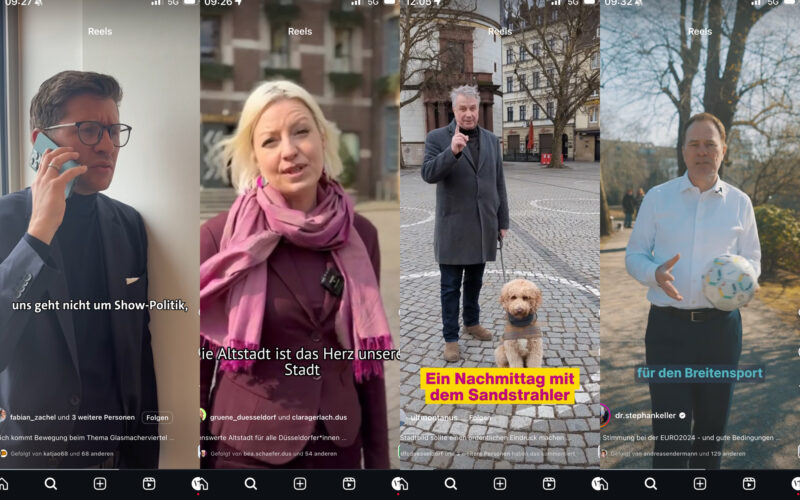Wie “Oskar“ Fernsehstimmen wieder hörbar macht

Eigentlich geht es für Marcel Faller seit 17 Jahren darum, möglichst jede Nuance eines Tons hörbar zu machen. Mit seinem Unternehmen Sonoro hat er sich auf hochwertige Lautsprecher spezialisiert. Liebhaberstücke. Doch dann kam sein Vater zu ihm und bat ihn um das genaue Gegenteil. Er wollte die ganzen Nebengeräusche nicht mehr hören, sondern beim Fernsehen die Stimmen der Schauspieler wieder richtig verstehen. Die Lösung heißt „Oskar“ und verkaufte sich in diesem Jahr häufiger als das gesamte übrige Sonoro-Portfolio zusammenaddiert – seit dem Start im Juli 2022 sogar 50.000 Mal.
Während Faller die Geschichte mit seinem Vater erzählt, sitzt er im Besprechungsraum seiner Firma im Neusser Osten. Drinnen sieht man Gründer und Inneneinrichtung an, dass es bei Sonoro neben Klang immer auch um Design geht. Draußen, hinten der großen Fensterfront, verschwimmt die Neusser Industriekulisse hinter trübem Dezember-Dunst. Die Geschichte passt sehr gut in Fallers Selbstverständnis als Problemlöser für seine Kunden. „Und wenn mein Vater nicht mein Lieblingskunde ist, wer dann?“
„Oskar“ ist ein kleiner tragbarer Lautsprecher mit silber-glänzendem Tragegriff und sieht simpel aus. Der Weg dorthin war es nicht. „Es war uns nicht klar, dass wir das lösen können“, sagt Faller.
Dass das Problem so viele Menschen betrifft, hat zwei Ursachen: Die eine hat mit den Menschen selbst zu tun. Vor allem mit den Senioren, für die der Fernseher das „Sozialmedium Nummer Eins“ ist. So sagt es zumindest Mirco Bornemann, der für die neugegründete Marke verantwortlich ist und im Besprechungsraum gleich neben Marcel Faller sitzt. Mit dem Alter verändert sich bei den Menschen das Hören. Die wahrnehmbaren Frequenzbereiche werden geringer, sich überlagernde Geräusche schwerer zu filtern.
Die zweite Ursache hat mit den Produktionsfirmen zu tun. Filme werden heute vor allem so gedreht, dass sich die Soundeffekte auf den teuren Anlagen besonders gut anhören. Wie das auf normalen Fernsehern ankommt und ob dann die Schauspieler noch gut zu verstehen sind, ist maximal Nebensache.
Die Folgen sind in vielen Familien ähnlich. Derjenige, der zuerst schlechter hört, dreht den Fernseher bald so laut, dass wahlweise Ehefrau oder Ehemann das Mitgucken kaum noch erträgt. Es gibt Streit um die Lautstärke, getrennte Fernseher – und so richtig hilft auch das laute Gerät nicht, weil die Soundeffekte gleich mithochgedreht werden. Der nächste Gang führt dann oft zum Akustiker und zum Hörgerät. Bis dahin vergehen meist Jahre. Jahre, die „Oskar“ erleichtern soll.
Neben den Sonoro-Ingenieuren waren Hör-Akustiker maßgeblich an der Entwicklung des kleinen Geräts beteiligt. Mit „hunderten“ von ihnen hätten sie zusammengearbeitet, sagt Bornemann, um zu verstehen, wie jemand mit Hörverlust hört und was er braucht. 70 Prozent der Lösung sei dann schon gewesen, dass die Box nah am Kunden stehen muss. Die anderen 30 Prozent waren ein größeres Ingenieursproblem. Heute erkennt ein Algorithmus im „Oskar“, was eine Stimme ist, und regelt alles andere herunter. Wie stark, das kann der Zuschauer mit einem Knopf am Rand des Geräts selbst festlegen. „Da haben wir gut zwei Jahre dran rumgedoktert“, sagt Faller. Auch die Herstellung ist aufwendig. Allein das Fräsen des Aluminiumrahmens dauert jeweils rund eine Viertelstunde.
Hör-Akustiker sind bis heute Teil des Erfolgsmodells geblieben. Denn wenn nun jemand zu ihnen kommt, weil er den Fernseher nicht versteht, empfehlen sie einen „Oskar“. Genauso die Fachhändler. Der zweite PR-Ansatz sind die klassischen Medien. Klassikradio, Printmagazine, Fernsehzeitungen. „Menschen rennen mit diesen Magazinen in der Hand zum Händler“, sagt Bornemann. Zu 90 Prozent seien es die Senioren selbst, die sich einen „Oskar“ kaufen. Immer wieder erreichen das Unternehmen Dankesschreiben, wie das einer Autorin, die nun endlich wieder deutlich den Ski-Kommentator verstehen kann.
Als das Produkt entwickelt war, wurde Faller und Bornemann klar, dass sie dafür eine eigene Marke brauchen. Zu groß sei sonst die Gefahr der Produktenttäuschung gewesen. Denn während Sonoro für den möglichst perfekten Klang steht, geht es beim „Oskar“ um etwas ganz anderes. Er ist ein Hilfsmittel, kein Luxusprodukt. Dass heute der Name „Faller“ auf dem kleinen Gerät steht und auf der Verpackung sogar Marcel Faller mit seinem Vater abgebildet ist, war zunächst nicht geplant. Es ist die Folge eines Markenstreits.
Zunächst habe die neue Marke „Anton“ heißen sollen, ein Wortspiel mit „Ton“ und „an“. Doch kurz vor Weihnachten 2021 folgte die Ernüchterung. Ein Wettbewerber hatte Einspruch gegen den Namen erhoben. Statt sich auf Gerichtsprozesse einzulassen, schlug Bornemann seinem Chef die Idee mit dessen Nachnamen vor. Nach anfänglichem Zögern sagt dieser zu. Und auch der Produktname selbst hat einen familiären Hintergrund. Marcel Fallers Opa hieß Oskar.
Nach dem Erfolg ihres ersten Faller-Produkts arbeiten sie in Neuss bereits an möglichen Nachfolgern. Veröffentlicht ist noch nichts, aber Bornemann gibt bereits einen Einblick in das, was einmal möglich sein soll. Restaurantbesuche, bei denen die gesamte Nebenakustik herausgefiltert wird und nur noch der Gesprächspartner zu hören ist. Rollfeldarbeiter am Flughafen, die statt mit ihrem gewaltigen Gehörschutz alles, irgendwann nur noch die störenden Turbinengeräusche ausblenden können. „Das ist eine riesige Spielwiese mit ganz vielen Möglichkeiten.“
Marcel Fallers größte Freude ist weiterhin die Sonoro-Sparte des Unternehmens: die Genussmomente, für die Musik seiner Meinung nach gemacht ist. Zuletzt war er bei einem Konzert in der Mitsubishi Electric Halle in Düsseldorf. Der Bass dort sei brutal gewesen, sagt er. Richtig gut. Doch wenn er zuhause Fernsehen schaut, da merkt er, dass er sich langsam auf den Oskar zubewegt. Statt des „Heckmecks“ mit den Soundeffekten geht es ihm dort immer mehr darum, einfach nur die Schauspieler zu verstehen.
Link und Preis
Ein „Oskar“ kostet 269 Euro. Mehr über das Gerät erfahren Sie auf der Homepage von Faller.